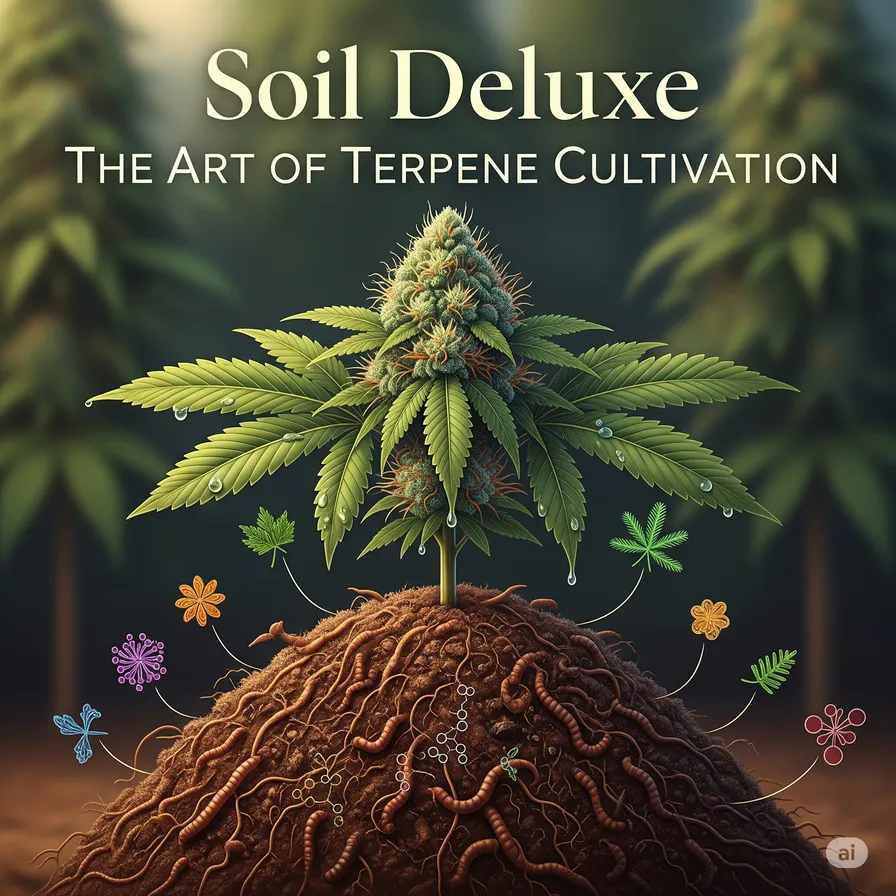Brackhaus’ Soil Deluxe
Aloha zusammen! Lasst uns Klartext reden: Ihr seid hier, weil ihr Cannabis wollt, das nicht nur wirkt, sondern explodiert – in Aroma, Geschmack und Charakter. Ihr wollt Terpene, die die Luft erfüllen, und eine Qualität, die man nicht nur raucht, sondern erlebt. Ich bin Herr Brackhaus, und nach Jahrzehnten des Tüftelns zeige ich euch, wie das geht. Das Geheimnis liegt nicht in der Flasche, sondern unter unseren Füßen: in einer lebendigen Erde. Wir werden hier nicht einfach nur gärtnern. Wir werden zu Boden-Chefköch*innen.
Dieser Leitfaden ist eure Einladung, den Spaten tiefer zu stecken und die faszinierende Magie der lebendigen Erde zu entdecken. Lasst uns loslegen.
Teil 1: An wen richte ich mich hier eigentlich?
An dich! Ja, genau dich. Bevor wir in die tiefen Geheimnisse des Bodens eintauchen, lasst uns klären, wer hier im Club willkommen ist. Denn dieser Leitfaden ist mehr als nur eine Anleitung; er ist eine Einladung an eine bestimmte Art von Geisteshaltung.
Wenn du dich in einer der folgenden Beschreibungen wiederfindest, dann bist du hier goldrichtig:
- Der/die ambitionierte Grünschnabel*in: Du hast die Nase voll von Foren-Mythen, widersprüchlichen Ratschlägen und dem ewigen Rätselraten, warum deine Blätter schon wieder seltsame Flecken haben. Du willst es von Anfang an richtig machen, ein solides Fundament an Wissen aufbauen und nicht erst drei Grows mit verkümmerten, blassgelben Blättern verbringen, bevor du auf den Trichter kommst. Du willst direkt in die Oberliga, weil du verstanden hast, dass der richtige Start alles entscheidet. Für diesen Ehrgeiz zolle ich dir Respekt!
- Der/die erfahrene Has*in: Du erntest schon gutes Zeug, keine Frage. Deine Freund*innen klopfen dir auf die Schulter, und deine Gläser sind immer gut gefüllt. Aber nachts, wenn du allein bist, schaust du auf deine Blüten und spürst es: Da geht noch mehr. Du hast ein Plateau erreicht. Deine Erträge sind stabil, aber die Komplexität im Aroma, diese eine besondere Note, die du bei einem anderen Strain geschmeckt hast, die will sich bei dir einfach nicht einstellen. Du willst von „gut“ zu „legendär“. Du willst das letzte, entscheidende Prozent an Aroma herauskitzeln – den extra klebrigen Harzmantel, der an den Fingern klebt wie Pattex. Du bist hier, um die Feinheiten zu meistern.
- Der/die Bio-Jünger*in: Für dich ist eine Pflanze mehr als nur eine Produzentin von psychoaktiven Substanzen. Du siehst das große Ganze. Du willst die Symbiose, die Verbindung, das leise Summen und Knistern des Lebens in deinem Topf spüren. Chemie ist für dich ein Schimpfwort. Du willst mit der Natur arbeiten, nicht gegen sie – und ein Produkt ernten, das so rein und unverfälscht ist, dass es die Essenz der Pflanze widerspiegelt. Für dich ist der Prozess genauso wichtig wie das Ergebnis.
- Der/die Connaisseur*in: Am Ende des Tages zählt für dich nur eines: die unanständig hohe, fast schon arrogante Qualität des Endprodukts. Du jagst nicht nach dem höchsten THC-Wert, du jagst nach dem perfekten Zusammenspiel. Du sprichst von sekundären Pflanzenstoffen – dem komplexen Orchester aus hunderten von Terpenen, Flavonoiden und Cannabinoiden, das für das einzigartige Aroma, den vielschichtigen Geschmack und die nuancierte Wirkung verantwortlich ist. Ein Aroma, das den Raum füllt, sobald du das Glas nur einen Spalt öffnest. Ein Geschmack, der Geschichten von Früchten, Erde und Gewürzen erzählt. Eine Wirkung, die klar, rein und facettenreich ist. Du rauchst nicht, du degustierst. Du bist hier, weil du verstanden hast, dass die Methoden in diesem Artikel der Schlüssel sind, um das volle genetische Potenzial dieser sekundären Pflanzenstoffe zu entfesseln.
Kurz gesagt: Wenn du keine Lust mehr hast, nur bunte Flaschen nach einem starren Schema zu kippen, sondern der/die Dirigent*in deines eigenen kleinen Cannabis-Orchesters werden willst, um eine Sinfonie der Aromen zu erschaffen, dann lehn dich zurück. Die Show beginnt jetzt.
Teil 2: Das Fundament – Von der Strategie zur Wissenschaft des Geschmäcks
Ein fundamentaler Paradigmenwechsel: Vom/von der Chemikerin zum/zur Boden-Chefköchin
Jetzt kommt ein entscheidender Punkt, der oft für Verwirrung sorgt. Wenn ich sage: „Vergesst für einen Moment alles, was ihr über N-P-K-Werte auswendig gelernt habt“, dann ist das kein Aufruf, mit dem Düngen aufzuhören. Ganz im Gegenteil. Es ist ein Aufruf, die Art und Weise, wie wir über Düngung denken, von Grund auf zu revolutionieren.
Die alte Welt: Der/die Chemiker*in im Growzelt
Die „alte Welt“ ist die des/der Chemikerin. Der/die Chemikerin betrachtet die Pflanze als ein passives Gefäß. Er/sie sieht einen Mangel (zum Beispiel gelbe Blätter), schaut auf seine/ihre N-P-K-Tabelle und kippt eine isolierte, chemische Nährstofflösung darauf, um die Pflanze zwangsweise zu ernähren. Das funktioniert, keine Frage. Es ist wie eine Infusion im Krankenhaus – effektiv, aber unnatürlich und eindimensional. Man behandelt Symptome, nicht die Ursache. Man ignoriert das komplexe System, in dem die Pflanze lebt.
Unsere neue Welt: Der/die Connaisseurin als Dirigentin des Ökosystems
Wir als Boden-Chefköchinnen drehen den Spieß um. Anstatt die Pflanze direkt zu mästen, kultivieren wir das unendlich komplexe Leben in unserer Erde. Wir decken den Tisch für ein Milliardenheer an Mikroben, und dieses Orchester aus Köchinnen, Bodyguards und Lieferdiensten versorgt unsere Pflanze dann mit einer maßgeschneiderten Gourmet-Diät – genau dann, wenn sie hungrig ist.
Was bedeutet das für euer Düngeschema?
Ihr werft euren organischen Dünger nicht weg! Euer Bio-Düngeschema (egal ob von einer Marke oder eure eigene Komposition) ist weiterhin die Grundversorgung – das sind die hochwertigen Lebensmittel im Kühlschrank. Die in diesem Artikel beschriebenen Methoden (AACT, KNF etc.) sind die Gourmet-Köch*innen, die diese Lebensmittel aufschließen, veredeln und der Pflanze als perfektes Fünf-Sterne-Menü servieren.
Stickstoff, Phosphor und Kalium sind immer noch die Bausteine des Lebens. Aber sie sind das Ergebnis eines gesunden, biologischen Prozesses – nicht die direkte, isolierte Zutat, die wir in den Topf kippen. Wir denken nicht mehr in starren Werten, sondern in lebendigen Kreisläufen. Das ist der Sprung vom/von der Gärtnerin zum/zur Meisterin.
2.1 Die Wahl deiner Leinwand
Jeder große Künstlerin braucht eine gute Leinwand. Unsere ist die Erde. Und Hand aufs Herz: Nicht jede Leinwand ist gleich. Deine Ausgangslage bestimmt die ersten Schritte. Finden wir heraus, welcher Typ du bist:
Szenario 1: Der/die Discounter-Dompteur*in (Baumarkt-/Discounter-Erde aufwerten)
Das ist der absolute Ground Zero. Du stehst mit einem Sack „Blumenerde“ für 3,99 € aus dem Baumarkt da. Keine Schande, jede*r fängt mal an. Aber sei dir bewusst: Das ist keine Leinwand, das ist bestenfalls Packpapier. Diese Erden sind oft torfbasiert, nährstoffarm, strukturschwach, neigen zur Verdichtung und sind biologisch so tot wie ein Stein. Oft sind sie sogar mit minderwertigen, chemischen Langzeitdüngern versetzt – und die wollen wir absolut nicht.
Dein Plan: Hier geht es nicht ums „Pimpen“, hier geht es um eine komplette Wiederbelebung. Du musst Struktur, Nahrung und Leben hinzufügen.
- Mische die Erde mit mindestens 30 % Strukturgebern (Perlit, Bimsstein, Lavagestein) für die Belüftung.
- Dann kommt das Futter: Gib 20 % hochwertigen Kompost und 10–20 % Wurmhumus hinzu.
- Für Langzeitwirkung: Eine Grunddüngung mit organischen Feststoffen wie Hornspänen, Urgesteinsmehl und Fledermaus-Guano (nach Herstellerangabe).
- Das ist eine Herz-Lungen-Massage für deine Erde.
Szenario 2: Der/die Marken-Magier*in (BioBizz & Co. veredeln)
Der Klassiker: Du hast dir einen Sack Light-Mix und vielleicht einen Sack All-Mix besorgt. Eine solide, grundierte Leinwand. Die Struktur ist in der Regel gut, eine leichte Grunddüngung ist vorhanden – aber das mikrobielle Leben ist im Dornröschenschlaf. Diese Erden sind pasteurisiert, um schädlingsfrei und lagerfähig zu sein – das tötet Schädlinge, aber eben auch nützliche Mikroben.
Dein Plan:
- Mische Light-Mix und All-Mix (z. B. 50/50).
- Werte diese Basis mit 10–20 % exzellentem Wurmhumus auf. Eine Handvoll guter Kompost schadet nie.
- Ziel: nicht die NPK-Werte verändern, sondern eine vielfältige und potente Armee an Mikroben impfen.
- Du schaffst die Voraussetzung, dass unsere späteren „Zaubertränke“ überhaupt jemanden zum Füttern finden.
Szenario 3: Der/die Galerist*in (Fertige Living Soils)
Du bist schlauer – oder einfach bequemer. Du hast dir eine fertige Living Soil von einem namhaften Hersteller wie „Muddis Erde“ oder „Florganics“ besorgt. Glückwunsch! Du hast dir eine hochwertige, vorgemischte und oft bereits gereifte Leinwand aus der Galerie geholt. Die schwere Arbeit des Mischens und Balancierens wurde dir abgenommen.
Dein Plan:
- Fokus nicht auf Aufbau, sondern Aktivierung und Pflege.
- Die Erde ist ein potentes Ökosystem, aber durch Transport und Lagerung vielleicht etwas schläfrig.
- Dein erster Komposttee (AACT) ist hier der Weckruf, nicht nur eine Impfung.
- Du kannst direkt mit der Aktivierung beginnen – die „Kochphase“ entfällt in der Regel.
Szenario 4: Der/die Michelangelo*in (Die ultimative Eigenmischung)
Das hier ist die Königsklasse. Die „Porno-Variante“, wie ich sie gerne nenne. Für die Besessenen unter uns, die Perfektionistinnen, die Connaisseurinnen, die wissen: Das Beste entsteht nur, wenn man jede einzelne Komponente selbst auswählt.
Du hast dir die besten Zutaten aus aller Welt besorgt: kanadischen Torf, Kokosfasern aus Sri Lanka, Wurmhumus von Würmern, die nur Bio-Abfälle fressen, Fledermaus-Guano aus indonesischen Höhlen, isländisches Seetangmehl und Vulkangestein aus der Eifel.
Dein Plan:
- Du bist der/die Alchemist*in. Du mischst nicht nur, du komponierst.
- Aber Vorsicht: Diese Erde ist ein schlafender Drache.
- So voll mit potenten Nährstoffen, dass sie eine junge Pflanze verbrennen würde.
- Die „Kochphase“ ist hier nicht optional, sondern überlebenswichtig:
- Mindestens 2, besser 4 Wochen reifen lassen, feucht halten, gelegentlich wenden.
Egal, für welche Leinwand du dich entscheidest, das Prinzip bleibt dasselbe. Aber bevor wir lernen, die Pinsel zu schwingen und die Farben zu mischen, müssen wir verstehen, wie die Pigmente auf molekularer Ebene überhaupt entstehen. Schnall dich an – wir machen einen kurzen, aber entscheidenden Ausflug in den Maschinenraum der Pflanze.
2.2 Primär- vs. Sekundärstoffwechsel: Der ewige Kompromiss der Pflanze
Jede Pflanze, von der mickrigen Geranie auf Omas Fensterbank bis zu unserer geliebten Cannabis-Diva, führt ein Doppelleben. Sie hat zwei grundlegend verschiedene Stoffwechselwege:
- Primärstoffwechsel: Das ist das Basis-Betriebssystem. Es ist verantwortlich für alles, was die Pflanze zum reinen Überleben und Wachsen braucht: Photosynthese (Energie gewinnen), Zellteilung (größer werden), Atmung (Energie verbrauchen). Die Produkte sind universell: Zucker, Fette, Proteine. Das Ergebnis ist Biomasse – also mehr Blätter, längere Stängel, größere Wurzeln.
- Sekundärstoffwechsel: Das ist das hochspezialisierte Luxus-Programm. Es wird erst dann richtig hochgefahren, wenn das Basis-Überleben gesichert ist. Dieser Stoffwechsel produziert die sogenannten sekundären Pflanzenstoffe (SPS). Das sind die Terpene, die für den Duft nach Zitrone, Kiefer oder Benzin sorgen. Das sind die Flavonoide, die den Blüten ihre violetten Farbtöne verleihen.1 Und ja, das sind auch die Cannabinoide wie THC und CBD. Diese Stoffe sind für das reine Wachstum nicht essenziell, aber sie sind die chemische Antwort der Pflanze auf ihre Umwelt. Sie sind ihre Sprache, ihre Waffe und ihr Schutzschild.
2.3 Die “Wachstums-Differenzierungs-Balance-Hypothese” (GDBH) im Brackhaus-Style
Wissenschaftler*innen haben für den Kompromiss zwischen diesen beiden Stoffwechselwegen einen furchtbar sperrigen Namen: die “Growth-Differentiation Balance Hypothesis”. Ich nenne es das “Bodybuilder-vs-Karateka-Prinzip”.
Stellt euch vor, eine Pflanze hat 100 Energiepunkte.
- Der Bodybuilder (Hohe Nährstoffverfügbarkeit): Wenn ihr eine Pflanze mit Unmengen an leicht verfügbarem, chemischem Dünger vollstopft, schreit ihr ganzer Organismus: “WACHSEN!” Sie steckt alle 100 Energiepunkte in den Primärstoffwechsel. Das Ergebnis ist ein riesiger, grüner Bodybuilder. Massig Biomasse, große Blätter, dicke Stängel. Aber fragt diesen Bodybuilder mal, ob er sich gegen einen Angriff verteidigen kann. Er hat all seine Energie in Muskelmasse gesteckt und nichts für die Kampfkunst (Differenzierung, SPS-Produktion) übriggelassen. Er ist groß, aber schwach, anfällig für Schädlinge und schmeckt am Ende fad.
- Der Karateka (Ausgewogene, lebendige Erde): In unserer lebendigen Erde ist das Nährstoffangebot nicht unbegrenzt und sofort verfügbar. Die Pflanze muss dafür arbeiten, sie muss mit den Mikroben kommunizieren. Sie bekommt alles, was sie braucht, aber sie schwimmt nicht im Überfluss. Sie kann vielleicht nur 70 Energiepunkte ins Wachstum stecken. Was macht sie mit den restlichen 30? Sie investiert sie in ihre Kampfkunst – in die Differenzierung. Sie produziert ein komplexes Arsenal an sekundären Pflanzenstoffen. Sie wird vielleicht nicht der größte Bodybuilder im Raum, aber sie ist eine durchtrainierter Karateka. Sie ist widerstandsfähig, gesund und ihre Blüten sind vollgepackt mit dem Zeug, das wir wollen: Aroma, Geschmack und Wirkung.
Unsere gesamte Strategie zielt darauf ab, diesen Karateka zu trainieren, nicht einen aufgepumpte*n Bodybuilder zu mästen. Es ist ein geniales Rahmenwerk, um die Ressourcenverteilung zu verstehen, auch wenn die Reaktion der Pflanze in der Realität noch komplexer ist und jeder sekundäre Pflanzenstoff etwas anders reagieren kann.4
2.4 Induzierte Systemische Resistenz (ISR): Das Trainingslager für das Immunsystem
Stellt euch das Immunsystem einer Pflanze in steriler Erde wie einen verwöhnten Büroangestellten vor – weich, untrainiert und beim ersten Anzeichen von Ärger (Schädlingen) völlig überfordert. Unsere Mikroben hingegen sind der/die Personal Trainerin, der/die die Pflanze jeden Tag ins Bootcamp schickt. Sie täuschen Angriffe an, zwingen sie zu Liegestützen und härten sie ab. Das Ergebnis ist kein Bürohengst, sondern eine Elitesoldatin.
Wenn dann eine echter Feindin – sagen wir, Mehltau oder eine Spinnmilbe – an die Tür klopft, wartet die Pflanze nicht erst, bis der/die Feindin im Wohnzimmer steht. Sie verschwendet keine Zeit mit der Analyse der Lage. Sie schlägt sofort und mit voller Wucht mit ihrem gesamten chemischen Arsenal an sekundären Pflanzenstoffen zurück. Die Produktion von Abwehr-Terpenen und Phenolen wird explosionsartig hochgefahren.2
Eine Pflanze in einer sterilen, chemisch gedüngten Umgebung ist wie ein/e Soldatin, der/die noch nie eine Übung mitgemacht hat. Eine Pflanze in unserer lebendigen Erde ist ein/e kampferprobter Veteran*in. Und dieser ständige, leichte Stress, dieses permanente Training, ist einer der Hauptgründe, warum unsere Pflanzen am Ende so unglaublich reich an komplexen Aromen und Wirkstoffen sind. Sie produzieren diese Stoffe nicht, weil wir es wollen, sondern weil ihr von den Mikroben trainiertes Immunsystem sie als Teil ihrer natürlichen, robusten Abwehrstrategie herstellt.
2.5 Willkommen in der Unterwelt – Das Boden-Nahrungsnetz (Soil Food Web) im Detail
Bevor wir unsere Zaubertränke anrühren, müssen wir die Stadt verstehen, in der wir sie servieren. Stellt euch den Boden nicht als stillen Vorratskeller vor, sondern als die New Yorker Grand Central Station zur Rush Hour – nur dass hier nicht mit Aktenkoffern, sondern mit Nährstoff-Atomen gehandelt wird. Dieses wuselige, unsichtbare Ökosystem ist das Boden-Nahrungsnetz, oder wie die Koryphäe auf diesem Gebiet, Dr. Elaine Ingham, es nennt: das Soil Food Web (SFW).3 Es ist die Grundlage für alles, was wir tun.
Die gesamte Energie für dieses System kommt von der Sonne. Die Pflanze ist der erste Akteur; sie betreibt Photosynthese und wandelt Sonnenlicht in chemische Energie um, gespeichert in Form von Zuckern und Kohlenhydraten.6 Ein Großteil dieser Energie, bis zu 40 %, wird nicht für das eigene Wachstum verwendet, sondern über die Wurzeln als sogenannte Exsudate in den Boden abgegeben.3 Das ist die Währung, mit der die Pflanze ihre unterirdischen Mitarbeiter bezahlt. Und wer sind diese Mitarbeiter? Schauen wir uns die wichtigsten Trophieebenen an – also, wer wen frisst.
Erste Trophieebene: Die Produzenten
Hier steht die Pflanze selbst. Sie ist ein Autotroph, was bedeutet, dass sie ihre eigene Nahrung herstellt. Sie ist die Bank, die das Geld (Kohlenstoffverbindungen) druckt, das die gesamte unterirdische Wirtschaft am Laufen hält.
Zweite Trophieebene: Die Primärzersetzer
Das sind die ersten, die am Buffet der Wurzelexsudate speisen. Sie sind die fundamentalen Arbeitstiere in unserem System.
- Bakterien – Die Chemiker*innen und Nährstoff-Tresore: Stellt euch Bakterien als winzige, lebende Rucksäcke vor. Sie sind die “Arbeitspferde” des Bodens, Meister der Zersetzung, die sich mit Nährstoffen vollstopfen, die für die Pflanze allein unerreichbar wären.8 Stickstoff, Phosphor, Schwefel – alles wird in diesen mikrobiellen Schließfächern sicher verwahrt und vor dem Auswaschen geschützt.10 Sie sind wie die unzähligen kleinen Händler und Banker der Stadt, die die Rohstoffe verarbeiten und lagern.
- Pilze – Das Internet und die Schwerlast-Spedition: Pilze sind das Glasfasernetzwerk des Bodens. Ihr Myzel, ein unendlich feines Geflecht aus Hyphen, erstreckt sich meilenweit, verbindet Pflanzen miteinander und transportiert Wasser und schwer lösliche Nährstoffe wie Phosphor direkt an die Wurzel-Haustür.9 Sie sind die Schwerlast-Spedition, die selbst komplexe, holzige Materialien (Lignin, Zellulose) zerlegen kann, an denen Bakterien scheitern würden. Sie sind die Logistik- und Kommunikationsinfrastruktur der Unterwelt.9
Dritte & Vierte Trophieebene: Die Regulatoren & Jäger
Hier geschieht die eigentliche Magie der Nährstoffversorgung. Denn die Nährstoffe, die in den Bakterien und Pilzen gespeichert sind, müssen erst wieder freigesetzt werden, um für die Pflanze verfügbar zu sein. Das ist der Job der Jäger.
- Protozoen & Nematoden – Die Nährstoff-Lieferanten: Diese größeren Einzeller (Protozoen) und mikroskopisch kleinen Würmer (Nematoden) sind die Raubtiere, die auf Bakterien und Pilze Jagd machen.8 Und genau hier schließt sich der wichtigste Kreislauf für uns als Boden-Chefköch*innen: die Mikrobielle Schleife (Microbial Loop).14
Stellt euch das so vor: Die Pflanze lockt mit ihren zuckerhaltigen Wurzelausscheidungen gezielt Bakterien an. Diese Bakterien haben ein sehr enges Kohlenstoff-zu-Stickstoff-Verhältnis (C:N-Verhältnis), etwa 5:1. Das bedeutet, sie brauchen für 5 Teile Kohlenstoff 1 Teil Stickstoff, um ihre Körper zu bauen. Sie saugen also den Stickstoff aus dem Boden auf und speichern ihn in sich. Sie sind die “Dünger-Säcke”.10
Jetzt kommen die Protozoen ins Spiel. Sie haben ein viel weiteres C:N-Verhältnis, etwa 30:1. Wenn ein Protozo frisst, um seinen Kohlenstoffbedarf zu decken, nimmt es dabei eine massive Überdosis an Stickstoff auf. Was macht es damit? Es scheidet den Überschuss aus – und zwar in Form von pflanzenverfügbarem Ammonium (NH₄⁺), direkt vor der Haustür der Pflanzenwurzel.16 Die Protozoen sind also die “Dünger-Streuer”.10
Das ist der geniale Mechanismus, mit dem unsere Pflanze ihre Ernährung steuert. Sie hungert? Sie gibt mehr Zucker ab, lockt mehr Bakterien an, die wiederum mehr Raubtiere anlocken, die dann den Nährstoff-Lieferdienst starten. Das ist keine passive Fütterung, das ist ein aktiver, bedarfsgesteuerter Lieferservice auf Abruf. Das ist das Herzstück unserer Boden-Chefküche.
2.6 Das Nährstoff-Hotel – Die Kationenaustauschkapazität (KAK)
Eine geschäftige Metropole wie unser Boden-Nahrungsnetz braucht eine solide Infrastruktur. Sie braucht Straßen, Lagerhäuser und Banken. In der Bodenchemie nennen wir diese Infrastruktur die Kationenaustauschkapazität (KAK).17
Stellt euch die KAK als ein riesiges Luxushotel für Nährstoffe vor.18 Die Wände dieses Hotels bestehen aus den feinsten Partikeln im Boden: Tonmineralen und, viel wichtiger, Humus.19 Diese Partikel sind von Natur aus negativ geladen.20
- Die Hotelzimmer (Austauschplätze): Jede negative Ladung an einem Ton- oder Humuspartikel ist wie ein freies Hotelzimmer oder ein Parkplatz. Die Nährstoffe, die unsere Pflanze braucht – wie Calcium (Ca²⁺), Magnesium (Mg²⁺) und Kalium (K⁺) – sind positiv geladene Ionen, sogenannte Kationen. Wie Magneten werden diese positiven Nährstoff-Gäste von den negativen Hotelwänden angezogen und “checken ein”.19 Sie werden sicher gehalten und vor dem Auswaschen durch Regen oder Gießwasser geschützt.
- Der Portier (pH-Wert): Der pH-Wert des Bodens agiert wie der Portier des Hotels. Er entscheidet, wie viele Zimmer verfügbar sind und wer einchecken darf. In einem sauren Boden (niedriger pH-Wert) gibt es eine Flut von positiv geladenen Wasserstoff-Ionen (H⁺). Diese Hooligans besetzen die besten Zimmer und lassen für die wertvollen Nährstoff-Gäste keinen Platz.19 Je neutraler der pH-Wert, desto mehr Zimmer stehen für Calcium, Magnesium und Co. zur Verfügung.
- Humus, der Fünf-Sterne-Flügel: Und hier kommt der absolute Superstar ins Spiel: Humus. Wenn Tonminerale ein solides Motel am Stadtrand sind, dann ist Humus das Ritz-Carlton im Zentrum. Humuspartikel haben aufgrund ihrer komplexen Struktur und der vielen funktionellen Gruppen (wie Carboxyl- und Phenolgruppen) eine gigantische Anzahl an negativen Ladungen – ihre KAK ist um ein Vielfaches höher als die von Ton.9 Ein Boden reich an Humus ist ein Fünf-Sterne-Luxusresort, das Unmengen an Nährstoffen und Wasser speichern kann.
- Die Zimmerbelegung (Kationenverhältnis): Es ist nicht nur wichtig, dass die Hotelzimmer belegt sind, sondern auch von wem. Das Verhältnis der Kationen zueinander, insbesondere von Calcium zu Magnesium, bestimmt die physikalische Struktur des Bodens. Ein idealer Calciumanteil (ca. 60-70 %) wirkt wie ein guter Baumeister, der die Bodenteilchen zu stabilen, krümeligen Aggregaten verklumpt. Das Ergebnis ist eine luftig-krümelige Struktur wie ein perfekter Schokokuchen. Ein Überschuss an Magnesium hingegen, dessen Ionen eine größere Wasserhülle haben, wirkt wie ein schlechter Mörtel. Bei Nässe wird der Boden schmierig und klebrig, bei Trockenheit zieht er sich zusammen und wird hart wie ein schlecht gebrannter Ziegel.20
Die biologische Aktivität des Boden-Nahrungsnetzes und die chemische Stabilität der KAK sind untrennbar miteinander verbunden. Ein gesundes Bodenleben, das organische Materie zersetzt, baut kontinuierlich Humus auf. Dieser Humus erhöht die KAK des Bodens dramatisch. Eine hohe KAK wiederum schafft ein stabiles, gepuffertes Milieu – ein perfektes Habitat mit reichlich gespeicherten Nährstoffen und Wasser –, in dem das Bodenleben florieren kann. Es ist ein sich selbst verstärkender Kreislauf: Biologie baut Chemie, die wiederum mehr Biologie ermöglicht. Das ist der Grund, warum das Hinzufügen von Kompost und organischem Material so unglaublich wirkungsvoll ist – wir füttern nicht nur die Pflanze, wir bauen das gesamte Hotel aus.
Teil 3: Die Alchemisten-Küche – Herrn Brackhaus’ Geheimrezepte
Nachdem wir nun verstanden haben, warum wir einen trainierten Karateka und keinen aufgepumpte*n Bodybuilder züchten wollen, kommen wir zur Praxis. Das hier ist das Dojo. Jedes dieser Rezepte ist eine spezifische Trainingseinheit, um die Ausdauer, die Abwehrkräfte und die explosive Kraft unserer Pflanze zu formen.
Anleitung 1: Hochpotenter Komposttee (AACT)
Ziel: Eine explodierende Population nützlicher Mikroben züchten, um das Bodenleben zu impfen und Nährstoffe zu mobilisieren. Studien haben gezeigt, dass belüfteter Komposttee die mikrobielle Biomasse und Aktivität im Boden signifikant erhöhen kann, was zu verbessertem Pflanzenwachstum und einer Unterdrückung von Krankheitserregern führt.24 Wir brauen eine lebendige Suppe!
Bakterien vs. Pilze: Den Tee an die Pflanzenphase anpassen
Der entscheidende Kniff bei der AACT-Herstellung ist die Steuerung, welche Mikroorganismen wir primär vermehren wollen. Dies geschieht über die Art der Nahrung, die wir ihnen geben.
- Bakteriell dominanter Tee (für die Wachstumsphase): Bakterien lieben einfache Zucker. Sie vermehren sich explosionsartig, wenn sie leicht verfügbare Nahrung bekommen. Dieser Tee ist ideal für die vegetative Phase, da die hohe Bakterienaktivität Stickstoff schnell verfügbar macht und so das Blatt- und Stängelwachstum fördert.
- Pilzlich dominanter Tee (für die Blütephase): Pilze bevorzugen komplexere Kohlenhydrate und Proteine. Ein pilzdominanter Tee fördert das Myzel-Wachstum im Boden, was entscheidend für die Mobilisierung von Phosphor ist – dem wichtigsten Baustein für eine üppige Blüten- und Harzproduktion.
Zutaten für 20L:
-
Mikroben-Quellen (Die Basis für beide Teesorten): 2-3 Tassen hochwertiger Wurmhumus, 1 große Handvoll frischer Wald-Humus, 1 Tasse Luzerne-Pellets, 1 Tasse Wiesenheu-Presslinge und 1-2 EL Leinkuchen.
-
Futter (Wähle je nach Ziel):
- Für einen bakteriellen Tee (Wachstum): 2-3 EL ungeschwefelte Schwarze Zuckerrohrmelasse.
- Für einen pilzlichen Tee (Blüte): 1 EL ungeschwefelte Schwarze Zuckerrohrmelasse (als Startenergie), 2 EL Seealgenmehl, 1 EL Fischhydrolysat (optional) und eine Handvoll Haferflocken.
Herstellung:
-
Wasser vorbereiten: 20L Leitungswasser für mindestens 24 Stunden mit einer starken Luftpumpe belüften. Das Chlor muss raus, der Sauerstoff muss rein.25 Wir wollen unsere Mikroben ja nicht vergiften. (Mehr zu Wasserqualität in Teil 6).
-
Brauen: Gebt die “Mikroben-Quellen” in einen Komposttee-Beutel (ein einfacher 300-400 Mikron-Nylonstrumpf tut’s auch). Hängt den Beutel ins Wasser. Gebt das gewählte “Futter” direkt ins Wasser und rührt gut um. Schaltet die Pumpe ein und sorgt für eine stark sprudelnde, rollende Bewegung.
-
Dauer:
- Bakterieller Tee: 24 Stunden bei 18-22°C brauen.
- Pilzlicher Tee: 36 Stunden bei 18-22°C brauen, da Pilze länger zur Vermehrung brauchen.
-
Geruchstest & Sicherheitswarnung: Der fertige Tee muss angenehm erdig-süß riechen. Stinkt er faulig oder sauer, ist etwas schiefgegangen – dann weg damit und neu ansetzen!26 Aber Vorsicht: Ein guter Geruch ist keine Garantie für Sicherheit! Der Brauprozess ist ein Inkubator für alle Mikroben, auch für potenziell schädliche wie E. coli oder Salmonella.12 Verwendet nur hochwertigsten Kompost und reinigt eure Ausrüstung peinlich genau.
Anwendung:
- Gießen: 1:5 bis 1:10 mit chlorfreiem Wasser verdünnen und den Boden damit großzügig wässern.
- Top-Dressing: Den feuchten Inhalt des Teebeutels nicht wegwerfen! Das ist pures Gold. Mischt es mit etwas Malzgerstenpulver (Enzym-Booster) und verteilt es als Düngerschicht auf der Erde.
Anleitung 2: Milchsäurebakterien-Serum (LABS)
Ziel: Eine Armee von nützlichen Milchsäurebakterien (Lactobacillus) herstellen. Diese Bakterien sind dafür bekannt, organische Materie schnell zu zersetzen und durch die Produktion von organischen Säuren die Verfügbarkeit von Mineralien zu erhöhen.28 Sie verbessern die Nährstoffaufnahme, balancieren den Boden-pH und unterdrücken Krankheitserreger.29
Herstellung:
- Reis waschen: Wascht 1 Tasse Bio-Reis mit Wasser und fangt das erste, milchige Wasser auf. Das ist voller Stärke, dem Lieblingsessen unserer Bakterien.30
- Fermentieren: Füllt das Reiswasser in ein Glas (nur zu 2/3 voll, es braucht Platz zum Atmen), deckt es mit einem Tuch ab und lasst es 5-7 Tage bei Raumtemperatur stehen, bis es leicht süß-säuerlich riecht.
- Selektieren: Siebt die Flüssigkeit ab und mischt sie mit der 10-fachen Menge Milch (Verhältnis 1:10). Wieder abdecken und weitere 5-7 Tage stehen lassen. Die Milchsäurebakterien werden die Milch nun fermentieren.30
- Ernten: Die Milch trennt sich in drei Schichten: oben der Quark, unten der Bodensatz. Die mittlere, gelblich-klare Flüssigkeit (Molke) ist euer fertiges, hochkonzentriertes LABS.
Lagerung & Anwendung: Im Kühlschrank lagern (Deckel nur locker aufschrauben, es lebt!). Immer stark verdünnt anwenden (1:1000 mit Wasser). Ein paar Tropfen genügen!
Brackhaus’ Tipp zum Quark – Das Festmahl der Mikroben (und eine Warnung an die Naschkatzen)
Was machen wir mit dem feinen Quark, der oben schwimmt? Wegwerfen? Niemals! In der Welt des Connaisseurs wird nichts verschwendet. Dieser Quark ist pures Protein und ein Festessen für eure Bodenbiologie.
- Für den Topf (Die sichere Methode): Und hier ist Präzision gefragt, meine Freundinnen! Schmiert den Quark niemals einfach wie Frischkäse obendrauf auf eure Mulchschicht. Das ist eine offene Einladung für allerlei unerwünschte Schimmelpilze, die wir definitiv nicht in unserem Garten haben wollen. Stattdessen machen wir es wie die Profis: Hebt an einer Stelle die Mulchschicht vorsichtig an, zerbröselt eine kleine Menge des Quarks direkt auf die darunterliegende Erdoberfläche und legt die Mulchdecke wieder darüber oder noch besser mischt ihn in die oberste Erdschicht. So bleibt der Quark im Dunkeln und Feuchten, wo unsere nützlichen Bodenmikroben ihn finden und zersetzen können, bevor er an der Luft schimmelt. Er ist ein fantastisches Langzeitfutter, quasi das Protein-Pulver für die hart arbeitenden Mikroben in eurer Erde.
- Für den Mund (ACHTUNG!): Ich weiß, was ihr jetzt denkt. Sieht aus wie Quark, riecht vielleicht sogar ein bisschen wie Käse – kann man das essen? Die kurze Antwort: NEIN! Die lange Antwort: Lasst die Finger davon! Wir haben hier eine wilde Fermentation mit Mikroben aus der Luft gestartet, nicht in einem sterilen Lebensmittellabor. Neben unseren nützlichen Laktobazillen könnten sich auch unerwünschte Gäste wie fiese Magen-Darm-Bakterien in der Milchparty breitgemacht haben.31 Dieses Rezept ist ein Gourmet-Menü für eure Pflanzen, aber für euren Magen ist es russisches Roulette. Also, Regel Nummer eins im Brackhaus-Club: Wir füttern den Boden, nicht das Krankenhaus!
Anleitung 3: Fermentierter Pflanzen- & Fruchtsaft (FPJ & FFJ)
Ziel: Wachstumshormone, Enzyme und Nährstoffe direkt aus Pflanzen (FPJ für Wachstum) und Früchten (FFJ für Blüte) durch Osmose extrahieren. Diese Methode extrahiert effektiv pflanzeneigene Hormone (wie Auxine und Cytokinine) und leicht verfügbare Nährstoffe, die das Pflanzenwachstum direkt beeinflussen können.32
Herstellung:
-
Material sammeln:
- Für FPJ (Wachstum): Sammelt morgens junge, vitale Pflanzentriebe (Brennnessel für Stickstoff und Kieselsäure, Beinwell für Kalium, schnell wachsende “Unkräuter” für Wachstumshormone).34 Nicht waschen! Die wertvollen Mikroben auf der Oberfläche wollen wir behalten.36
- Für FFJ (Blüte): Verwendet reife, süße Früchte (Bananen für Kalium, Mangos oder Kürbis für Phosphor und Enzyme).37
-
Mischen: Das Material klein schneiden und im Gewichtsverhältnis 1:1 mit braunem Zucker mischen. Der Zucker zieht durch Osmose den Saft aus den Zellen und dient den Mikroben als Nahrung.34
-
Fermentieren: Die Mischung in ein Glas pressen (2/3 voll), mit einem Tuch abdecken und 5-7 Tage an einem kühlen, dunklen Ort stehen lassen.
-
Ernten: Die entstandene, sirupartige Flüssigkeit abseihen und die Feststoffe kräftig auspressen.
Lagerung & Anwendung: Im Kühlschrank lagern (Deckel locker!). Immer stark verdünnt anwenden (1:500 bis 1:1000 mit Wasser). FPJ in der Vegi, FFJ in der Blüte.
Anleitung 4: Einheimische Mikroorganismen (IMO) – Neu interpretiert!
Ziel: Die unübertroffene genetische Vielfalt und Robustheit der lokalen Mikroben für unser System nutzen. Diese Jungs sind an unser Klima angepasst und extrem widerstandsfähig. Sie sind die Navy SEALs unter den Mikroben.39
Die alte Idee vs. die neue Erkenntnis: Früher dachten wir, wir könnten einfach eine Armee von Waldmikroben sammeln und in unseren Topf verpflanzen, wo sie dann die Macht übernehmen. Die Wissenschaft zeigt uns aber ein nuancierteres Bild: Ein etabliertes Bodenökosystem ist ein hart umkämpftes Pflaster. Eine erfolgreiche feindliche Übernahme durch eine kleine, von außen kommende Truppe ist unwahrscheinlich.²² Der wahre Zauber der IMO-Methode liegt wahrscheinlich nicht in der Inokulation, sondern in der Herstellung eines extrem nährstoffreichen und biologisch aktiven Zusatzstoffes. Wir transplantieren keine Armee, wir liefern ein Fünf-Sterne-Catering für die bereits vorhandenen Truppen in unserem Topf und geben ihnen damit die Energie, sich zu vermehren und zu gedeihen.1
Methode 1: Die schnelle Direkt-Fütterung (für den/die eiligen Connaisseurin)
- Das Vorgehen: Findet einen gesunden, unberührten Laubwald in eurer Nähe. Meidet Nadelwälder, da deren Boden oft zu sauer ist. Schiebt die oberste, trockene Blattschicht vorsichtig beiseite. Darunter findet ihr das Gold: dunklen, krümeligen und erdig riechenden Humus. Wenn ihr seht, dass er von feinen, weißen Pilzfäden (Myzel) durchzogen ist – Jackpot!
- Die Anwendung: Sammelt 1-2 große Handvoll dieses Materials. Gebt diesen “Waldboden-Extrakt” direkt mit in euren Komposttee-Beutel. Damit füttert ihr euren Tee mit einer unglaublichen Vielfalt an Nährstoffen und biologischen Verbindungen, die das Wachstum eurer vorhandenen Mikroben-Crew explodieren lassen.
Methode 2: Die Züchter-Methode (Eine eigene Super-Nahrung herstellen)
Das Ziel dieser Methode aus dem Korean Natural Farming (KNF) ist es, eine lagerfähige Super-Nahrung für eure Mikroben zu schaffen.40
- Schritt 1: Mikroben sammeln (IMO1): Koche Bio-Reis “al dente” (also nicht zu matschig). Fülle den noch warmen Reis in eine luftdurchlässige Box (z.B. eine Holz- oder Bambusbox).41 Vergrabe diese Box zur Hälfte in der potenten Humusschicht im Wald. Decke sie mit Laub ab und markiere die Stelle. Nach 5-7 Tagen ist der Reis mit einem flauschigen, meist weißen Myzel überzogen. Das ist eure IMO1-Sammlung. (Bunte oder schwarze Stellen deuten auf weniger erwünschte Schimmelpilze hin und sollten vermieden werden).41
- Schritt 2: IMO stabilisieren (IMO2): Wiege deine Reis-Myzel-Mischung (IMO1). Mische sie nun im Gewichtsverhältnis 1:1 mit braunem Zucker.40 Knete alles gut durch, bis eine homogene, feuchte Masse entsteht. Der Zucker entzieht den Mikroben das Wasser und versetzt sie in einen schlafenden, haltbaren Zustand. Fülle diese Masse in ein Glas (wieder nur zu 2/3 voll), decke es mit einem Tuch ab und lagere es an einem kühlen, dunklen Ort. Euer IMO2 ist nun für viele Monate haltbar.43
Die Anwendung: Von diesem IMO2-Konzentrat braucht ihr nur noch einen Esslöffel für euren Komposttee, um eine gewaltige Nährstoff- und Futterquelle für eure Mikroben bereitzustellen.
(Bitte seid bei beiden Methoden respektvoll zur Natur und sammelt nur kleine Mengen. Wir sind Gäste im Wald.)
Teil 4: Die unsichtbare Armee – Meine persönlichen Leibwächter
Eine Connaisseurin überlässt die Sicherheit seiner/ihrer Ladys nicht dem Zufall. Wir reagieren nicht auf einen Schädlingsbefall mit Panik und Giftspritzen. Wir lachen den Schädlingen ins Gesicht, bevor sie überhaupt daran denken, bei uns einzuziehen. Unsere Armee hat mehrere Divisionen, die perfekt zusammenspielen.
-
Die Pioniere & Ingenieure (Regenwürmer): Das ist die schwere Artillerie, die das Fundament legt. Regenwürmer (insbesondere Kompostwürmer wie Eisenia fetida) sind die unermüdlichen Ingenieure unseres Bodens. Sie graben konstant Tunnel, was zwei entscheidende Vorteile hat: Erstens belüften sie die Erde bis in tiefere Schichten und verhindern so Staunässe und Verdichtung – der absolute Tod für feine Cannabiswurzeln. Zweitens ziehen sie organisches Material von der Oberfläche (z.B. unsere Mulchschicht) nach unten, mischen es durch und machen es für andere Mikroben zugänglich. Ihr Kot, der berühmte Wurmhumus, ist der wohl beste organische Dünger der Welt: pH-neutral, voller Enzyme, Hormone und langsam freisetzbarer Nährstoffe.
-
Die Bodentruppen (Nematoden & Raubmilben): Das ist unsere unterirdische Spezialeinheit.
- Nützliche Nematoden: Diese mikroskopisch kleinen Würmer sind die natürlichen Feinde von Trauermückenlarven. Sie dringen in die Larven ein, vermehren sich darin und eliminieren so die Brutstätte, bevor die nervigen Fliegen überhaupt schlüpfen können. Nebenbei sind sie, wie wir wissen, Teil des Nährstoffkreislaufs. Was für ein fantastischer Service!
- Raubmilben: Das Security-Team an der Oberfläche. Sie patroulieren unermüdlich auf der Erde und der Mulchschicht und jagen aktiv alles, was da nicht hingehört: die Eier und Larven von Trauermücken, die Puppen von Thripsen und andere unliebsame Gäste.
-
Die Luftwaffe (Marienkäfer & Florfliegen): Während die Bodentruppen die Stellung halten, kümmert sich unsere Luftwaffe um Bedrohungen aus der Luft und auf den Blättern.
- Marienkäfer: Jeder kennt sie, aber die wenigsten wissen, was für unersättliche Raubtiere sie (und besonders ihre Larven) sind. Ein einziger Marienkäfer kann in seinem Leben Tausende von Blattläusen vertilgen. Sie sind die perfekte Antwort auf einen beginnenden Blattlausbefall.
- Florfliegenlarven (“Blattlauslöwen”): Wenn Marienkäfer die Luftwaffe sind, dann sind Florfliegenlarven die gnadenlosen Elitesoldaten. Sie fressen nicht nur Blattläuse, sondern auch Spinnmilben, Thripse und andere Weichhautinsekten. Sie sind wahre Allrounder und eine der besten Investitionen in die proaktive Schädlingsbekämpfung.
Der Einsatzplan: Wir schicken unsere Armee einmalig und gestaffelt zu Beginn in den Kampf, und zwar mit einem klaren Schlachtplan:
- Pioniere zuerst: Die Regenwürmer kommen direkt mit der Erde in den Topf.
- Bodentruppen nachrücken lassen: Direkt nach dem ersten Angießen mit Komposttee bringen wir die Nematoden und Raubmilben aus.
- Luftunterstützung bei Bedarf: Marienkäfer und Florfliegen halten wir in Reserve. Beim ersten Anzeichen eines Schädlings auf den Blättern werden sie ausgesetzt und erledigen den Job, bevor er zum Problem wird.
So schaffen wir eine lebendige, sich selbst verteidigende Festung, bevor der Feind überhaupt weiß, dass es hier das beste Cannabis der Stadt zu holen gibt.
Teil 5: Die Kunst des Connaisseurs – Fortgeschrittene Techniken für die ewige Erde
Was ihr bisher gelernt habt, ist das Fundament. Jetzt bauen wir die Kathedrale. Dieser Abschnitt ist für diejenigen, die nicht nur einen Grow, sondern ein Vermächtnis schaffen wollen. Wir verwandeln euren Topf in ein sich selbst erhaltendes, immer besser werdendes Ökosystem.
5.1 No-Till im Topf – Warum Wegwerfen für Anfänger*innen ist
Die radikalste und zugleich logischste Idee im organischen Anbau ist das No-Till-Prinzip, also das Gärtnern ohne Umgraben oder Austauschen der Erde.44 Die Philosophie ist einfach: Jedes Mal, wenn wir die Erde umgraben oder wegwerfen, zerstören wir das empfindliche Myzel-Netzwerk der Pilze und die über Zyklen aufgebaute Bodenstruktur.46 Wir machen die harte Arbeit unserer mikrobiellen Armee zunichte.
Die Praxis im Topf ist elegant, aber sie braucht Volumen: Für ein wirklich stabiles, sich selbst regulierendes Ökosystem, das über mehrere Zyklen immer besser wird, ist das Topfvolumen entscheidend. Während man mit kleineren Töpfen starten kann, ist ein Volumen von mindestens 30 Litern ein hervorragender Ausgangspunkt für ambitionierte No-Till-Gärtner*innen.11 Größere Behälter bieten noch mehr Puffer und Stabilität.
- Ernte: Schneidet die Pflanze am Ende ihres Lebenszyklus direkt an der Erdoberfläche ab. Lasst den gesamten Wurzelballen im Topf.
- Vorbereitung: Lockert nur die obersten 2-3 cm der Erde vorsichtig mit den Fingern oder einer kleinen Harke auf.
- Re-Amending: Jetzt füttern wir die Erde für den nächsten Zyklus. Wir bringen eine Schicht neuer Nährstoffe und organischer Materie auf, das sogenannte “Top-Dressing”.
- Neuanfang: Pflanzt den neuen Sämling oder Klon direkt in die verjüngte Erde.
Der alte Wurzelballen ist dabei kein Abfall, sondern das Festmahl für den nächsten Zyklus. Während er langsam von Pilzen und Bakterien zersetzt wird, gibt er die Nährstoffe frei, die die vorherige Pflanze gespeichert hat. Er wird zu einer langsam freisetzenden Kohlenstoffquelle und hinterlässt ein perfektes Netzwerk aus Kanälen, die für Belüftung sorgen und den neuen Wurzeln den Weg weisen.47 Anstatt eure Erde als verbrauchtes Substrat zu sehen, behandelt ihr sie wie einen guten Wein, der mit jedem Jahrgang an Komplexität und Wert gewinnt.
Das Re-Amending Rezept für den Neustart:
Hier ist eine bewährte Mischung, um eurer Erde neues Leben einzuhauchen. Die Mengenangaben sind Richtwerte pro 30 Liter Topfvolumen.48
| | Zutat | Menge pro 30L Erde | Zweck | | Hochwertiger Kompost/Wurmhumus | 3-5 Liter | Neue Mikroben, organische Masse, Nährstoffe | | Kelp-Mehl | 2 Esslöffel | Spurenelemente, Wachstumshormone 51 | | Neem-Presskuchen | 2 Esslöffel | Langzeit-N, Schädlingsabwehr 52 | | Krabbenmehl | 2 Esslöffel | P, Ca, Chitin für Immun-Boost 53 | | Basaltmehl/Urgesteinsmehl | 3 Esslöffel | Silizium, Spurenmineralien 54 |
5.2 Die hohe Kunst des Top-Dressings – Gezielte Fütterung für Gourmets
Top-Dressing ist mehr als nur Düngen. Es ist das gezielte Hinzufügen von “Gewürzen” und “Superfoods” zu unserer Bodenküche, um ganz bestimmte Reaktionen in der Pflanze hervorzurufen. Hier sind die wichtigsten Zutaten aus unserem Re-Amending-Rezept im Detail:
- Kelp-Mehl: Das ultimative Multivitamin aus dem Meer. Es liefert über 60 Spurenelemente und, was noch wichtiger ist, natürliche Pflanzenhormone wie Auxine und Cytokinine. Diese helfen der Pflanze, mit Stress umzugehen, insbesondere mit Hitzestress, und fördern ein robustes Wachstum.51
- Neem-Presskuchen: Der Bodyguard im Topf. Er liefert langsam freisetzenden Stickstoff und enthält Azadirachtin, eine Verbindung, die von der Pflanze aufgenommen wird und systemisch gegen saugende und fressende Schädlinge wirkt.57 Zudem hemmt er die Nitrifikation, was bedeutet, dass Stickstoff im Boden stabilisiert und vor dem Auswaschen geschützt wird.59
- Krabbenmehl (Crab Meal): Die Geheimwaffe für Terpene. Es liefert zwar Calcium und Phosphor, aber seine wahre Magie liegt im Chitin, dem Hauptbestandteil der Insektenpanzer und Pilzzellwände.53 Wenn die Pflanzenwurzeln Chitin im Boden wahrnehmen, schlagen sie Alarm. Sie interpretieren es als einen direkten Angriff von Schädlingen oder pathogenen Pilzen. Diese Wahrnehmung löst eine Chitin-Induzierte Systemische Resistenz (CIR) aus.60 Die Pflanze fährt daraufhin ihr gesamtes chemisches Abwehrarsenal hoch und produziert präventiv eine Flut von sekundären Pflanzenstoffen – genau die Terpene, Flavonoide und Cannabinoide, die wir wollen!.2 Wir füttern also nicht nur die Pflanze, wir hacken ihr Immunsystem, um die Terpen-Produktion auf Hochtouren zu bringen.
- Gips (Gypsum): Der Boden-Conditioner. Gips ist eine fantastische Quelle für Calcium und Schwefel, die den pH-Wert nicht anhebt. Das macht ihn perfekt, um das Calcium-Magnesium-Verhältnis zu optimieren und schwere, lehmige Böden aufzulockern, ohne die Chemie aus dem Gleichgewicht zu bringen.
- Basaltmehl: Das mineralische Fundament. Dieses Urgesteinsmehl ist eine langsam freisetzende Quelle für Silizium, das die Zellwände stärkt und die Pflanze widerstandsfähiger gegen Schädlinge und Stress macht. Zudem liefert es ein breites Spektrum an Spurenmineralien, die in vielen anderen Düngern fehlen.
5.3 Living Mulch – Der lebende Teppich im Topf
Wir haben bereits über die Wichtigkeit einer Mulchschicht gesprochen. Aber warum bei totem Material aufhören? Ein “Living Mulch” ist eine niedrig wachsende Begleitpflanze, die wir direkt in den Topf säen, um einen lebenden, atmenden Teppich zu schaffen.
Der perfekte Kandidat dafür ist Weißklee (Trifolium repens). Und hier ist, warum er so genial ist:
- Stickstoff-Fabrik: Als Leguminose geht Weißklee eine Symbiose mit Knöllchenbakterien (Rhizobien) ein, die Stickstoff direkt aus der Luft binden und ihn im Boden für unsere Cannabis-Pflanze verfügbar machen. Er ist eine kleine, kontinuierlich laufende Düngerfabrik.
- Bodenschutz: Der dichte Teppich schützt die oberste Erdschicht vor dem Austrocknen und vor zu starker Sonneneinstrahlung. Das hält das empfindliche mikrobielle Leben direkt unter der Oberfläche feucht, kühl und aktiv.
- Feuchtigkeitsanzeiger: Der Klee zeigt euch, wann es Zeit zum Gießen ist. Wenn er anfängt, die Blätter hängen zu lassen, hat eure Cannabis-Pflanze noch Reserven, aber ihr wisst, dass es bald so weit ist.
- Ein Wort zur Balance: Bedenkt, dass der Lebendmulch auch ein Konkurrent ist. Im begrenzten Raum eines Topfes konkurriert er mit eurer Cannabis-Pflanze um Wasser und Nährstoffe.26 Haltet den Klee daher kurz und managt ihn aktiv, damit er nicht zur Bedrohung für eure Hauptkultur wird.
Die Anwendung ist denkbar einfach: Sobald eure Cannabis-Pflanze eine stabile Größe erreicht hat, streut ihr einfach ein paar Weißklee-Samen auf die Erdoberfläche und gießt sie leicht an.
5.4 Mykorrhiza – Das unterirdische Super-Netzwerk
Wenn die Wurzeln die Straßen der Stadt sind, dann ist Mykorrhiza ein landesweites, unterirdisches Tunnelsystem, das Nährstoffe aus den entlegensten Winkeln heranschafft. Es handelt sich um eine Symbiose zwischen speziellen Pilzen und den Pflanzenwurzeln.
Es gibt zwei Haupttypen: Ektomykorrhiza, die ein Netz um die Wurzeln bildet (hauptsächlich bei Bäumen), und Endomykorrhiza, die mit ihren Hyphen in die Wurzelzellen eindringt, um dort bäumchenartige Strukturen (Arbuskel) für den Nährstoffaustausch zu bilden. Cannabis geht eine Partnerschaft mit Endomykorrhiza ein.
Dieses Pilznetzwerk vergrößert die aufnahmefähige Oberfläche des Wurzelsystems um das Hundert- oder sogar Tausendfache. Es ist besonders effektiv bei der Erschließung von Phosphor, einem Nährstoff, der im Boden oft schwer verfügbar ist.9
Die Anwendung ist entscheidend: Der Mykorrhiza-Impfstoff (Inokulum) muss in direkten Kontakt mit den Wurzeln kommen. Die beste Zeit dafür ist beim Umtopfen. Streut das Granulat direkt ins Pflanzloch, sodass die Wurzeln hineinwachsen. Eine einmalige, korrekte Anwendung reicht für das gesamte Leben der Pflanze.
Teil 6: Wasser, pH & EC: Mythen der alten Welt entlarvt und neu bewertet
Hier trennt sich die Spreu vom Weizen. Wer die folgenden Prinzipien versteht, befreit sich von der Sklaverei des ständigen Messens und Korrigierens und beginnt, dem von ihm geschaffenen System zu vertrauen – aber mit Verstand.
6.1 Das Lebenselixier – Warum dein Leitungswasser deine Mikroben töten könnte
Wir geben uns all diese Mühe, ein blühendes mikrobielles Leben in unserem Topf zu kultivieren. Und dann? Dann kommen viele und ertränken es in Gift. Unser Leitungswasser ist darauf ausgelegt, Keime abzutöten. Dafür wird es mit Chlor oder, noch hartnäckiger, mit Chloramin versetzt. Wenn ihr dieses Wasser direkt in eure lebendige Erde gießt, ist das wie ein Flächenbombardement auf eure mikrobielle Metropole.
Die Lösung ist einfach, aber essenziell:
- Gegen Chlor: Chlor ist flüchtig. Lasst euer Gießwasser einfach 24 Stunden offen stehen oder belüftet es für ein paar Stunden mit einer Aquariumpumpe. Das Chlor gast aus und ist unschädlich.
- Gegen Chloramin: Das ist der fiese Cousin von Chlor. Es ist viel stabiler und gast NICHT aus, wenn man das Wasser stehen lässt. Hier ist die beste Lösung ein hochwertiger Aktivkohlefilter (z.B. ein Aufsatz für den Wasserhahn). Dieser filtert sowohl Chlor als auch Chloramin zuverlässig heraus, lässt aber die wertvollen Mineralien wie Calcium und Magnesium im Wasser.
6.2 Die Tyrannei der Zahlen – Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser
In der Welt des chemischen Anbaus oder der Hydroponik ist der Grower ein Chemiker. Er muss ständig den pH-Wert und den EC-Wert (elektrische Leitfähigkeit, ein Maß für die Salzkonzentration) messen und mit Säuren oder Basen korrigieren. Warum? Weil das sterile Medium keine Pufferkapazität hat.
In unserer lebendigen Erde ist das anders. Wer hier panisch mit pH-Down-Flaschen hantiert, hat das Prinzip nicht verstanden und schadet seinem Bodenleben mehr, als er nützt.60 Eure lebendige Erde ist ein sich selbst regulierendes Puffer-System.
Der hohe Gehalt an organischer Substanz und Humus sorgt für eine enorme chemische Pufferwirkung (eine hohe KAK, wie wir in Teil 2.6 gelernt haben). Sie fängt pH-Schwankungen ab wie ein Stoßdämpfer. Viel wichtiger ist aber die biologische Regulation: Die Pflanze ist kein passives Opfer des pH-Wertes. Sie ist eine aktive Gestalterin! Über ihre Wurzelausscheidungen gibt sie gezielt saure oder alkalische Verbindungen ab, um den pH-Wert in ihrer unmittelbaren Wurzelumgebung (der Rhizosphäre) so zu verändern, dass genau die Nährstoffe löslich und verfügbar werden, die sie gerade in diesem Moment benötigt.
ABER, und das ist ein entscheidendes Aber: Die Pufferkapazität eures Bodens im Topf ist endlich.13 Besonders wenn ihr hartes, alkalisches Leitungswasser verwendet, fügt ihr mit jedem Gießen Substanzen hinzu, die den pH-Wert langsam aber sicher nach oben treiben.35 Über mehrere Zyklen kann dieser Effekt den Puffer eures Bodens erschöpfen, was zu einem blockierten Nährstoffhaushalt und kranken Pflanzen führt.13 Ein guter erster Schritt ist, die Wasserqualität zu kennen. In Deutschland stellen die meisten Wasserversorger aktuelle Trinkwasseranalysen auf ihren Webseiten zur Verfügung. So könnt ihr Werte wie den pH-Wert und die Alkalinität (Härte) eures Leitungswassers herausfinden.
Die goldene Regel lautet daher: Vertraue deinem System, aber überprüfe es. Anstatt täglich panisch zu messen, mache ein- oder zweimal pro Grow einen einfachen „Slurry Test“ (1 Teil Erde, 1,5 Teile destilliertes Wasser, mischen, 15 Minuten warten, messen), um sicherzustellen, dass dein pH-Wert nicht langsam in eine gefährliche Richtung driftet. Das ist kein Mikromanagement, das ist verantwortungsvolles System-Management.
Teil 7: Der Fahrplan zur Perfektion
Hier ist der genaue Ablauf. Kein Raten, keine Mythen, nur Ergebnisse.
| Phase | Ziel | Herrn Brackhaus’ Empfehlung | | Vorbereitungsphase | Festung bauen, Tisch decken. | Einmaliges Gießen mit AACT. Danach einmalige Anwendung von Nematoden & Raubmilben. Erde 3-5 Tage entspannen lassen. | | Wachstumsphase (Veg) | Ein vitales, starkes Monster erschaffen. | AACT (bakteriell-dominant): Alle 1-2 Wochen. FPJ: 1x pro Woche als Blattdüngung für den extra Kick an Wuchskraft. | | Blüteeinleitung (Stretch) | Die Weichen für die Blütenpracht stellen. | FPJ/FFJ (aus unreifen Früchten): Signalisiert der Pflanze: “Zeit für Babys, äh, Blüten!” | | Frühe Blüte (Woche 2-4) | Das Gerüst für schwere Colas bauen. | AACT (pilzlich-dominant): Mobilisiert den wichtigen Phosphor für eine massive Anzahl an Blütenansätzen. | | Mittlere Blüte (Woche 5-7) | Vollgas auf Dichte und Terpene! | FFJ (aus reifen Früchten): Liefert Kalium und Enzyme. LABS: Optimiert die Nährstoffaufnahme. | | Finale Reife & Ernte | Die Krönung des Meisters. | Düngung nach Schema bis ca. 1 Woche vor der Ernte. Letzte Woche nicht mehr gießen. Letzte 24-36h komplette Dunkelheit. |
Teil 8: Die Krönung des Werks: Trocknen & Curen für maximale Terpene
Ihr habt es fast geschafft. Ihr habt eine Pflanze gezüchtet, die vor Harz und Aroma nur so strotzt. Jetzt kommt der entscheidende, letzte Akt, bei dem die meisten die Früchte ihrer harten Arbeit ruinieren. Das Trocknen und Aushärten (Curing) ist keine lästige Pflicht, es ist die finale Veredelung, die aus einem guten Produkt ein legendäres macht. Dies ist nur eine Einführung in ein komplexes Thema, das wir später noch vertiefen werden.
8.1 Die Kunst des Loslassens – Die Wissenschaft der langsamen Trocknung
Das Ziel ist nicht, die Blüten so schnell wie möglich trocken zu bekommen. Das Ziel ist, das Wasser so langsam und kontrolliert wie möglich zu entziehen, um zwei entscheidende Prozesse zu ermöglichen: den Abbau unerwünschter Stoffe und den Erhalt der wertvollen.
- Der Chlorophyll-Abbau: Der scharfe, kratzige “Heu”- oder “Rasen”-Geschmack von schlecht getrocknetem Cannabis kommt vom Chlorophyll. Während einer langsamen Trocknung bei idealen Bedingungen haben die pflanzeneigenen Enzyme Zeit, das Chlorophyll in geschmacks- und geruchslose Zucker und Stärken abzubauen. Dadurch wird das darunterliegende, wahre Terpenprofil erst freigelegt.
- Die Flüchtigkeit der Terpene: Terpene sind das, worum es hier geht. Sie sind aber auch flüchtige organische Verbindungen. “Flüchtig” bedeutet, sie verdampfen leicht. Wärme, Licht und zu viel Luftbewegung geben diesen Molekülen die Energie, um zu entweichen.53 Einige der empfindlichsten Terpene beginnen bereits bei Temperaturen um 21-22°C zu verfliegen.51 Eine langsame, kühle, dunkle und sanfte Trocknung ist daher eine physikalische Notwendigkeit, um eure Aromen zu bewahren.
Die idealen Bedingungen sind: **16-20°C, ca. 60 % relative Luftfeuchtigkeit, absolute Dunkelheit und ein sanfter, indirekter Luftaustausch.**54
8.2 Die Lotus-Methode – Kühlschrank-Trocknung für den/die ultimativen Connaisseurin
Für diejenigen, die das absolute Maximum an Terpenerhalt anstreben, gibt es eine Methode, die das “langsam und kühl”-Prinzip auf die Spitze treibt: die Kühlschranktrocknung, auch bekannt als Lotus-Methode. Hier nutzen wir einen frostfreien Kühlschrank, um eine ultra-stabile, kalte und dunkle Umgebung zu schaffen, die flüchtige Terpene perfekt konserviert.
- Vorbereitung: Trimmt eure Blüten (nass oder trocken) und legt sie locker in Papiertüten oder ungefärbte Pappkartons (Pizzakartons sind ein Geheimtipp).
- Umgebung: Verwendet einen sauberen, frostfreien Kühlschrank, der idealerweise nur für diesen Zweck genutzt wird. Die Temperatur sollte bei stabilen 4-7°C liegen. Der frostfreie Mechanismus sorgt für einen konstanten, sanften Entzug der Feuchtigkeit.
- Prozess: Legt die Tüten oder Kartons in den Kühlschrank. Der Prozess ist deutlich länger als bei der herkömmlichen Methode und kann 2 bis 3 Wochen dauern.
- Kontrolle: Um den perfekten Trocknungsgrad zu bestimmen, nehmt ihr ein paar Test-Buds, legt sie in ein verschlossenes Glas mit einem kleinen Hygrometer und lasst sie sich bei Raumtemperatur für ein paar Stunden akklimatisieren. Wenn das Hygrometer stabile 60-65 % rLF anzeigt, sind die Blüten bereit für das Curing.
8.3 Die Reifung (Curing) – Vom guten Kraut zur Legende
Das Curing ist der letzte, entscheidende Reifeprozess in luftdichten Glasbehältern. Hierbei wird die Restfeuchtigkeit, die noch tief im Inneren der Blüten eingeschlossen ist, langsam nach außen verteilt. Dieser Prozess stoppt den reinen Wasserverlust und startet anaerobe Prozesse, die den Geschmack und die Wirkung weiter verfeinern.
- Die Praxis: Füllt eure getrockneten Blüten locker (zu ca. 75 %) in Einmachgläser. Lagert die Gläser an einem kühlen, dunklen Ort.
- Das “Rülpsen” (Burping): In den ersten ein bis zwei Wochen öffnet ihr die Gläser ein- bis zweimal täglich für einige Minuten. Dadurch entweicht die angesammelte Feuchtigkeit und Gase, und frischer Sauerstoff kommt herein.
- Die Perfektionierung: Nach den ersten zwei Wochen reicht es, die Gläser nur noch alle paar Tage zu lüften. Der eigentliche Reifeprozess dauert mindestens vier Wochen, aber wahre Connaisseure lassen ihre Schätze oft sechs Monate oder länger curen. Ein im Glas platziertes Hygrometer ist euer bester Freund. Das Ziel ist es, eine stabile relative Luftfeuchtigkeit von 58-62 % zu halten.
Teil 9: Der Schlachtplan – So, und jetzt ran an die Arbeit!
Genug der grauen Theorie, jetzt wird der Spaten in die Hand genommen! Dieser Teil ist euer konkreter, unmissverständlicher Schlachtplan für die ersten, entscheidenden Tage. Wer hier sauber arbeitet, legt den Grundstein für eine Ernte, die eure Freund*innen vor Neid erblassen lässt.
Schritt 1: Die Wahl der Waffen (Topf & Erde)
Bevor auch nur ein Tropfen Wasser fließt, trefft ihr die wichtigste Entscheidung. Wie in Teil 2.1 besprochen, ist eure Erde die Leinwand.
- Topfgröße: Denkt langfristig! Wenn ihr das No-Till-Prinzip (Teil 5.1) anwenden wollt, greift zu einem größeren Zuhause für eure Damen. Mindestens 30 Liter sind eine gute Hausnummer, mehr ist immer besser. Stofftöpfe sind eine exzellente Wahl, da sie die Wurzeln mit Sauerstoff versorgen und Staunässe verhindern.
- Erdmischung: Bereitet eure Erde gemäß eurem gewählten Szenario vor. Für die meisten ist Szenario 2 (Markenerde veredeln) der beste Kompromiss aus Aufwand und Qualität. Mischt also eure Bio-Erde mit einer guten Portion Wurmhumus. Füllt die Töpfe, aber lasst oben noch ca. 5-7 cm Platz für den späteren Mulch.
Schritt 2: Das Erweckungsritual (Der erste Guss)
Eure Erde ist im Topf, aber sie schläft noch. Jetzt wecken wir sie auf.
- AACT brauen: Setzt euren ersten hochpotenten Komposttee (Anleitung 1) an. Lasst ihm seine 24-36 Stunden, bis er erdig-süß duftet. Das ist keine Hexerei, das ist Biologie – gebt den Mikroben die Zeit, die sie brauchen.
- Das erste Angießen: Gießt die trockene Erde in den Töpfen langsam und gründlich mit dem verdünnten AACT, bis unten ein wenig Wasser herausläuft (Drainage). Damit habt ihr nicht nur gegossen, sondern euer gesamtes System mit einer vielfältigen, aktiven Mikrobenkultur geimpft. Die Party in eurem Topf hat soeben begonnen!
Schritt 3: Die Grenzsicherung (Nützlinge & Mulch)
Die Partygäste sind da, jetzt brauchen wir Türsteher und ein Dach über dem Kopf. Dieser Schritt sollte 1-2 Tage nach dem Angießen erfolgen, wenn die Erdoberfläche nicht mehr klatschnass, aber noch feucht ist.
- Bodentruppen ausbringen: Streut eure Nützlinge (Nematoden und Raubmilben) gleichmäßig auf der feuchten Erdoberfläche aus. Die Feuchtigkeit ist wichtig, damit die Nematoden nicht austrocknen und sofort auf die Jagd gehen können.
- Das Dach aufsetzen: Direkt im Anschluss bedeckt ihr die gesamte Erdoberfläche mit einer 2-3 cm dicken Schicht Mulch (am besten Stroh oder Wiesenheu). Dieser Schritt ist FUNDAMENTAL! Der Mulch schützt eure frisch ausgebrachten Nützlinge und die oberste, biologisch aktivste Erdschicht vor dem Austrocknen und vor Licht. Er ist die schützende Decke für euer gesamtes Ökosystem.
Schritt 4: Einzug der Königin (Das Pflanzen)
Euer 5-Sterne-Luxusresort ist nun bezugsfertig. Lasst eurer Erde nach dem Mulchen noch einen Tag Zeit, sich zu setzen. Dann ist es so weit.
- Schiebt den Mulch an der Pflanzstelle vorsichtig zur Seite.
- Hebt ein kleines Loch aus, das groß genug für den Wurzelballen eures Sämlings oder Klons ist.
- Profi-Tipp: Streut eine Prise Mykorrhiza-Granulat (Teil 5.4) direkt ins Pflanzloch. Das sorgt für den direkten Kontakt mit den Wurzeln und etabliert das unterirdische Super-Netzwerk von Anfang an.
- Setzt die Pflanze ein, füllt die Lücke mit Erde auf und drückt sie sanft an.
- Schiebt den Mulch wieder vorsichtig bis an den Stängel heran.
Schritt 5: Die Flitterwochen (Beobachten & Vertrauen)
Eure Arbeit ist für den Moment getan. Die Pflanze ist in ihrem neuen Zuhause, das System läuft. Jetzt kommt der schwierigste Teil für viele Gärtner*innen: Vertrauen haben und die Finger bei sich lassen!
- Gießen: Die Erde ist durch das erste Angießen noch feucht genug. Gießt erst wieder, wenn der Topf merklich leichter geworden ist. Eure Pflanze wird es euch danken.
- Beobachten: Schaut euch eure Pflanze täglich an. Nicht um Probleme zu suchen, sondern um zu lernen, wie eine gesunde, glückliche Pflanze aussieht. Seht zu, wie sie auf ihre neue, lebendige Umgebung reagiert.
Ihr habt soeben den Grundstein für eine Qualität gelegt, von der andere nur träumen. Willkommen im Club der Connaisseure.
Der 14-Wochen-Plan im Detail
Dieser Plan dient als Leitfaden für einen typischen Grow mit einer 4-wöchigen vegetativen Phase und einer 8-wöchigen Blütephase. Passt die Dauer der vegetativen Phase nach Bedarf an.
| Woche | Phase | Maßnahmen & Anwendungen (Herr Brackhaus’ Empfehlung) | | 1 | Erdvorbereitung 1 | Erde mischen (nach Szenario 1-4). Bei Eigenmischung (Szenario 4) die “Kochphase” starten: Erde anfeuchten und ruhen lassen. | | 2 | Erdvorbereitung 2 | Töpfe füllen. Ende der Woche: “Erweckungsritual” durchführen: Gründlich mit AACT gießen. Nützlinge ausbringen und mulchen. | | 3 | Wachstum (Veg) 1 | Pflanze einsetzen! Gießen nur mit chlorfreiem Wasser nach Bedarf. System beobachten und in Ruhe lassen. | | 4 | Wachstum (Veg) 2 | Pflanze etabliert sich. Anwendung: 1x AACT (bakteriell-dominant) gießen, um das Wachstum zu fördern. | | 5 | Wachstum (Veg) 3 | Kräftiges Wachstum. Anwendung: 1x FPJ als Blattspray für einen extra Wachstumsschub. | | 6 | Wachstum (Veg) 4 | Pflanze bereitet sich auf die Blüte vor. Anwendung: 1x AACT (bakteriell-dominant) gießen. Ggf. Living Mulch (Weißklee) aussäen. | | 7 | Blüteeinleitung | Licht auf 12/12 umstellen. Anwendung: 1x Gießen mit einer Mischung aus FPJ & FFJ, um der Pflanze das Signal zur Blütenbildung zu geben. | | 8 | Blüte 1 (Stretch) | Pflanze streckt sich stark. Anwendung: 1x AACT (pilzlich-dominant), um Phosphor für die Blütenansätze zu mobilisieren. | | 9 | Blüte 2 | Erste Blüten werden sichtbar. Anwendung: 1x FFJ (aus reifen Früchten) für Kalium und Enzyme. | | 10 | Blüte 3 | Blüten entwickeln sich. Anwendung: 1x AACT (pilzlich-dominant) und 1x LABS (an unterschiedlichen Tagen), um die Nährstoffaufnahme zu maximieren. | | 11 | Blüte 4 | Harzproduktion beginnt. Anwendung: 1x FFJ. Optional: Top-Dressing mit Krabbenmehl, um die Terpenproduktion anzukurbeln. | | 12 | Blüte 5 | Blüten werden dichter. Anwendung: 1x AACT (pilzlich-dominant). Ab jetzt nur noch Wasser und AACT, keine Säfte mehr. | | 13 | Blüte 6 (Reife) | Blüten reifen aus. Anwendung: Nur noch chlorfreies Wasser nach Bedarf geben. Beobachten der Trichome. | | 14 | Blüte 7 (Finale) | Spülen/Finale Reife. Anfang der Woche: Letztes Mal gießen. Letzte 24-48h: Komplette Dunkelheit. ERNTE! |
Ausblick: Was die Zukunft bringt…
Meine Freundinnen, was ihr hier in den Händen haltet, ist die Ouvertüre zu einer großen Oper. Es ist das Fundament, auf dem ihr Cannabis von Weltklasse-Qualität anbauen könnt. Aber für diejenigen unter euch, deren Wissensdurst unstillbar ist, für die wahren Alchemistinnen, die bis an die Grenzen des Möglichen gehen wollen – für euch ist dies erst der Anfang.
Die Methoden in diesem Leitfaden helfen euch, das volle genetische Potenzial eurer Pflanze auszuschöpfen. Aber sie können kein Potenzial erschaffen, das nicht von Anfang an in den Genen eurer gewählten Sorte verankert ist.24 Die wahre Meisterschaft liegt darin, zu verstehen, dass der Boden nur ein Teil des Orchesters ist. Faktoren wie die Lichtqualität (z.B. der gezielte Einsatz von UV-Licht zur Steigerung der Abwehrstoffe) und die atmosphärischen Bedingungen, die durch das Dampfdruckdefizit (VPD) beschrieben werden, spielen eine ebenso entscheidende Rolle für das Endergebnis.41
Die Welt des organischen Anbaus ist ein Universum voller faszinierender Themen, die wir in Zukunft gemeinsam erforschen werden. Bleibt also dran, meine Freund*innen – dit hier is noch lange nich fertig.
Aber jetz is Zeit für’n kleinen Denkzettel aus’m Grinder. Peace,
Herr B.
Anhang
Wichtiger Hinweis & Haftungsausschluss
Dieser Leitfaden dient ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken. Die hier beschriebenen Methoden, insbesondere die Herstellung von mikrobiellen Präparaten wie Komposttee und LABS, erfordern ein hohes Maß an Sauberkeit und Sorgfalt. Bei unsachgemäßer Handhabung besteht das Risiko der Vermehrung von unerwünschten oder potenziell schädlichen Mikroorganismen.
Der Autor übernimmt keine Haftung für Schäden an Pflanzen, Personen oder Eigentum, die aus der Anwendung der hier beschriebenen Techniken resultieren. Die Umsetzung erfolgt auf eigene Gefahr und in eigener Verantwortung. Es wird dringend empfohlen, bei allen Prozessen hygienisch zu arbeiten und die hergestellten Produkte ausschließlich für die Anwendung an Pflanzen zu verwenden. Informieren Sie sich zudem über die geltenden lokalen und nationalen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Anbaus von Cannabis und halten Sie diese strikt ein.
Ein Wort zur Wissenschaft & geprüfte Quellen
Eine echter Connaisseurin verlässt sich nicht auf Mythen und “Bro-Science” aus zwielichtigen Internetforen. Meine Methoden sind das Ergebnis jahrelanger, leidenschaftlicher Praxis, aber sie stehen auf den Schultern von Giganten – den Wissenschaftlerinnen, die ihr Leben der Erforschung des Bodens und der Pflanzen gewidmet haben. Was ich hier teile, ist keine Magie, sondern angewandte Biologie. Um meinem eigenen Anspruch an Präzision gerecht zu werden, findet ihr hier eine umfassende Bibliografie, die die Prinzipien dieses Leitfadens untermauert.
- Pollastri, F., & Tattini, M. (2011). Flavonoids: a colourful world of plant chemicals for human wellness. Inspired by nature, 4, 19-25.
- Pieterse, C. M., Van der Does, D., Zamioudis, C., Leon-Reyes, A., & Van Wees, S. C. (2012). Hormonal modulation of plant immunity. Annual Review of Cell and Developmental Biology, 28, 489-521.
- Ingham, E. R. (2005). The Compost Tea Brewing Manual: Latest Methods and Research. Soil Foodweb Inc.
- Lavelle, P., & Spain, A. V. (2001). Soil Ecology. Kluwer Academic Publishers.
- Coleman, D. C., Crossley Jr, D. A., & Hendrix, P. F. (2004). Fundamentals of Soil Ecology. Elsevier Academic Press.
- Taiz, L., & Zeiger, E. (2010). Plant Physiology (5th ed.). Sinauer Associates.
- Lambers, H., Chapin, F. S., & Pons, T. L. (2008). Plant Physiological Ecology (2nd ed.). Springer.
- Moore, J. C., Berlow, E. L., Coleman, D. C., de Ruiter, P. C., Dong, Q., Hastings, A.,… & Wall, D. H. (2004). Detritus, trophic dynamics, and biodiversity. Ecology Letters, 7(7), 584-600.
- Van der Heijden, M. G., Bardgett, R. D., & Van Straalen, N. M. (2008). The unseen majority: soil microbes as drivers of plant diversity and productivity in terrestrial ecosystems. Ecology Letters, 11(3), 296-310.
- Sylvia, D. M., Fuhrmann, J. J., Hartel, P. G., & Zuberer, D. A. (2005). Principles and Applications of Soil Microbiology. Pearson Prentice Hall.
- Schimel, J. P., & Bennett, J. (2004). Nitrogen mineralization: challenges of a changing global environment. Global Change Biology, 10(8), 1-19.
- Richardson, A. E., Barea, J. M., McNeill, A. M., & Prigent-Combaret, C. (2009). Acquisition of phosphorus and nitrogen in the rhizosphere and plant growth promotion by microorganisms. Plant and Soil, 321(1-2), 305-339.
- Bonfante, P., & Genre, A. (2010). Mechanisms underlying beneficial plant-fungus interactions in mycorrhizal symbiosis. Nature Communications, 1(1), 48.
- Clarholm, M. (1985). Interactions of bacteria, protozoa and plants leading to mineralization of soil nitrogen. Soil Biology and Biochemistry, 17(2), 181-187.
- Azam, F., Fenchel, T., Field, J. G., Gray, J. S., Meyer-Reil, L. A., & Thingstad, F. (1983). The ecological role of water-column microbes in the sea. Marine Ecology Progress Series, 10(3), 257-263.
- Ingham, E. R., Trofymow, J. A., Ingham, E. R., & Coleman, D. C. (1985). Interactions of bacteria, fungi, and their nematode grazers: effects on nutrient cycling and plant growth. Ecological Monographs, 55(1), 119-140.
- Brady, N. C., & Weil, R. R. (2016). The Nature and Properties of Soils (15th ed.). Pearson.
- Helling, C. S., Chesters, G., & Corey, R. B. (1964). Contribution of organic matter and clay to soil cation-exchange capacity as affected by the pH of the saturating solution. Soil Science Society of America Journal, 28(4), 517-520.
- Sparks, D. L. (2003). Environmental Soil Chemistry (2nd ed.). Academic Press.
- Bear, F. E., Prince, A. L., & Malcolm, J. L. (1945). The potassium-supplying powers of 20 New Jersey soils. Soil Science, 59(2), 139-149. (Basis für das Albrecht-Verhältnis)
- Albrecht, W. A. (1975). The Albrecht Papers: Vol. I, Foundation Concepts. Acres U.S.A.
- Stevenson, F. J. (1994). Humus Chemistry: Genesis, Composition, Reactions. John Wiley & Sons.
- Sposito, G. (2008). The Chemistry of Soils (2nd ed.). Oxford University Press.
- Essington, M. E. (2004). Soil and Water Chemistry: An Integrative Approach. CRC Press.
- Piccolo, A. (1996). Humus and soil conservation. In Humic Substances in Terrestrial Ecosystems (pp. 225-264). Elsevier.
- Scheuerell, S. J., & Mahaffee, W. F. (2002). Compost tea: Principles and prospects for plant disease control. Compost Science & Utilization, 10(4), 313-338.
- U.S. Environmental Protection Agency (EPA). (2015). Drinking Water Treatment.
- Ingham, E. R. (2009). The Field Guide for Actively Aerated Compost Tea. Soil Foodweb Inc.
- Zokaei, M., & Zade, H. G. (2014). The role of lactic acid bacteria in soil and plant. International Journal of Biosciences, 4(9), 374-381.
- Ouwehand, A. C., & Vesterlund, S. (2004). Antimicrobial components from lactic acid bacteria. In Lactic Acid Bacteria: Microbiological and Functional Aspects (pp. 375-396). Marcel Dekker.
- Higa, T., & Parr, J. F. (1994). Beneficial and Effective Microorganisms for a Sustainable Agriculture and Environment. International Nature Farming Research Center.
- Cho, H. K. (2011). Korean Natural Farming: Principles and Practice.
- U.S. Food & Drug Administration (FDA). (2018). Bad Bug Book: Foodborne Pathogenic Microorganisms and Natural Toxins.
- Rademacher, W. (2001). Growth retardants: effects on gibberellin biosynthesis and other metabolic pathways. Annual Review of Plant Biology, 52(1), 155-181.
- Xu, H. L. (2001). Effects of a fermented plant extract on growth and quality of tomato. Journal of Crop Production, 3(1), 173-181.
- Di-Addabbo, T., Sasanelli, N., & Lamberti, F. (1998). The effect of extracts from Urtica dioica (stinging nettle) on the mortality of Meloidogyne javanica. Nematologia Mediterranea, 26(2), 223-228.
- Stinner, B. R., & Stinner, D. H. (1989). The role of comfrey in sustainable agriculture. American Journal of Alternative Agriculture, 4(3-4), 111-117.
- Lattanzio, V., Lattanzio, V. M., & Cardinali, A. (2006). Role of phenolics in the resistance mechanisms of plants against fungal pathogens and insects. Phytochemistry: Advances in Research, 661(2), 23-67.
- Tucker, G. A. (1993). Introduction. In Biochemistry of Fruit Ripening (pp. 1-51). Chapman & Hall.
- Kloepper, J. W., & Schroth, M. N. (1981). Relationship of in vitro antibiosis of plant growth-promoting rhizobacteria to plant growth and the displacement of root microflora. Phytopathology, 71(10), 1020-1024.
- Khaliq, A., Abbasi, M. K., & Hussain, T. (2006). Effects of integrated use of organic and inorganic nutrient sources with effective microorganisms (EM) on seed cotton yield in Pakistan. Bioresource Technology, 97(8), 967-972.
- Cho, H. K., & Koyama, A. (1997). Korean Natural Farming: Indigenous Microorganisms.
- Park, H., & Du, Y. (2010). The Manual of Korean Natural Farming.
- Crowe, J. H., Carpenter, J. F., & Crowe, L. M. (1998). The role of vitrification in anhydrobiosis. Annual Review of Physiology, 60(1), 73-103.
- Edwards, C. A., & Bohlen, P. J. (1996). Biology and Ecology of Earthworms. Chapman & Hall.
- Lowenfels, J., & Lewis, W. (2010). Teaming with Microbes: The Organic Gardener’s Guide to the Soil Food Web. Timber Press.
- Montgomery, D. R. (2007). Dirt: The Erosion of Civilizations. University of California Press.
- Six, J., Elliott, E. T., & Paustian, K. (2000). Soil macroaggregate turnover and microaggregate formation: a mechanism for C sequestration under no-tillage agriculture. Soil Biology and Biochemistry, 32(14), 2099-2103.
- Hoitink, H. A. J., & Fahy, P. C. (1986). Basis for the control of soilborne plant pathogens with composts. Annual Review of Phytopathology, 24(1), 93-114.
- C.U.R.E. (Cannabis Users Restoration of the Environment). (n.d.). Build a Living Organic Soil.
- Lowenfels, J., & Lewis, W. (2014). Teaming with Nutrients: The Organic Gardener’s Guide to Optimizing Plant Nutrition. Timber Press.
- Stirk, W. A., & Van Staden, J. (2014). Plant growth regulators in seaweeds: occurrence, regulation and functions. Serial Reviews in Plant and Microbial Sciences, 33, 1-32.
- Schmutterer, H. (Ed.). (2002). The Neem Tree, Azadirachta indica A. Juss. and Other Meliaceous Plants: Sources of Unique Natural Products for Integrated Pest Management, Medicine, Industry and Other Purposes. VCH.
- Poveda, J., Eugui, D. C., & Abril-Urias, P. (2020). Chitin-based biostimulants: a sustainable strategy for the control of plant pathogens. International Journal of Molecular Sciences, 21(21), 8195.
- Van der Veen, J. W., & Van der Ent, S. (2015). Use of rock dust for soil remineralization. A review. Nutrient Cycling in Agroecosystems, 102(2), 163-181.
- Khan, W., Rayirath, U. P., Subramanian, S., Jithesh, M. N., Rayorath, P., Hodges, D. M.,… & Critchley, A. T. (2009). Seaweed extracts as biostimulants of plant growth and development. Journal of Plant Growth Regulation, 28(4), 386-399.
- Craigie, J. S. (2011). Seaweed extract stimuli in plant science and agriculture. Journal of Applied Phycology, 23(3), 371-393.
- Isman, M. B. (2006). Botanical insecticides, deterrents, and repellents in modern agriculture and an increasingly regulated world. Annual Review of Entomology, 51, 45-66.
- Koul, O., & Walia, S. (2009). Comparing the effects of neem-based and synthetic pesticides on the development and survival of the cotton bollworm, Helicoverpa armigera. Journal of Asia-Pacific Entomology, 12(1), 9-13.
- Kumar, B. S. D., & Reddy, K. S. (2001). Effect of neem cake and its extract on nitrification and N uptake in rice. Journal of the Indian Society of Soil Science, 49(3), 503-506.
- El Hadrami, A., Adam, L. R., El Hadrami, I., & Daayf, F. (2010). Chitosan in plant protection. Marine Drugs, 8(4), 968-987.
- Sharp, R. G. (2013). A review of the applications of chitin and its derivatives in agriculture to modify plant-microbial interactions and improve crop yields. Agronomy, 3(4), 757-793.
- Pichyangkura, R., & Chadchawan, S. (2015). Biostimulant activity of chitosan in horticulture. Scientia Horticulturae, 196, 49-65.
- Chen, L., & Dick, W. A. (2011). Gypsum as an agricultural amendment. General Use Guidelines, The Ohio State University Extension, Bulletin 945.
- Wallace, A. (1994). Use of gypsum on soil where needed can make such soil an important sink for atmospheric carbon dioxide. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 25(1-2), 109-116.
- Epstein, E. (1997). The Science of Composting. CRC Press.
- Datnoff, L. E., Snyder, G. H., & Korndörfer, G. H. (Eds.). (2001). Silicon in agriculture. Elsevier.
- Hartwig, N. L., & Ammon, H. U. (2002). Cover crops and living mulches. Weed Science, 50(6), 688-699.
- Teasdale, J. R. (1996). Contribution of cover crops to weed management in sustainable agricultural systems. Journal of Production Agriculture, 9(4), 475-479.
- Schipanski, M. E., & Drinkwater, L. E. (2012). Nitrogen fixation of red and white clover in response to nitrogen amendment. Nutrient Cycling in Agroecosystems, 92(2), 235-247.
- Peoples, M. B., Herridge, D. F., & Ladha, J. K. (1995). Biological nitrogen fixation: an efficient source of nitrogen for sustainable agricultural production? Plant and Soil, 174(1-2), 3-28.
- Creamer, N. G., & Bennett, M. A. (1997). Mulching for weed management in sustainable vegetable production. HortTechnology, 7(4), 400-404.
- Smith, S. E., & Read, D. J. (2008). Mycorrhizal Symbiosis (3rd ed.). Academic Press.
- Brundrett, M. C. (2009). Mycorrhizal associations and other means of nutrition of vascular plants: understanding the global diversity of host plants by resolving conflicting information and developing reliable means of diagnosis. Plant and Soil, 320(1-2), 37-77.
- Parniske, M. (2008). Arbuscular mycorrhiza: the mother of plant root endosymbioses. Nature Reviews Microbiology, 6(10), 763-775.
- Copes, W. E., & Klett, J. E. (2005). Inoculating with arbuscular mycorrhizal fungi. Colorado State University Extension, Fact Sheet No. 7.215.
- Jeffries, P., Gianinazzi, S., Perotto, S., Turnau, K., & Barea, J. M. (2003). The contribution of arbuscular mycorrhizal fungi in sustainable maintenance of plant health and soil fertility. Biology and Fertility of Soils, 37(1), 1-16.
- Zare-Maivan, H., & Gholipour, A. (2016). The effect of mycorrhizal fungi on growth and nutrient uptake of cannabis (Cannabis sativa L.). Journal of Plant Nutrition, 39(11), 1543-1550.
- World Health Organization (WHO). (2003). Chloramine in Drinking-water.
- U.S. Environmental Protection Agency (EPA). (2016). Basic Information about Chloramine in Drinking Water.
- Lowenfels, J. (2017). Teaming with Fungi: The Organic Grower’s Guide to Mycorrhizae. Timber Press.
- American Water Works Association (AWWA). (2011). Water Chlorination/Chloramination Practices and Principles.
- Jones Jr, J. B. (2012). Hydroponics: A Practical Guide for the Soilless Grower. CRC Press.
- Rorabaugh, P. A. (2010). The R-C-M-P System of Soil-Water Management.
- Hinsinger, P., Bengough, A. G., Vetterlein, D., & Young, I. M. (2009). Rhizosphere: biophysics, biogeochemistry and ecological relevance. Plant and Soil, 321(1-2), 117-152.
- Neumann, G., & Römheld, V. (2012). Rhizosphere chemistry in relation to plant nutrition. In Marschner’s Mineral Nutrition of Higher Plants (3rd ed., pp. 347-368). Academic Press.
- Clarke, R. C., & Merlin, M. D. (2013). Cannabis: Evolution and Ethnology. University of California Press.
- Small, E. (2015). Cannabis: A Complete Guide. CRC Press.
- Jin, D., Jin, S., & Chen, J. (2019). Cannabis drying and curing. Cannabis Science and Technology, 2(2), 40-45.
- Ross, S. A., & ElSohly, M. A. (1996). The volatile oil composition of fresh and air-dried buds of Cannabis sativa. Journal of Natural Products, 59(1), 49-51.
- Gentry, R. (2018). The Cannabis Breeder’s Bible. Green Candy Press.
- Russo, E. B. (2011). Taming THC: potential cannabis synergy and phytocannabinoid-terpenoid entourage effects. British Journal of Pharmacology, 163(7), 1344-1364.
- Cervantes, J. (2015). The Cannabis Encyclopedia: The Definitive Guide to Cultivation & Consumption of Medical Marijuana. Van Patten Publishing.
- Rosenthal, E. (2010). Marijuana Grower’s Handbook. Quick American Publishing.
- Z. (2020, May 15). The Lotus Cure: Cold-Drying Cannabis.
- Leafly Staff. (2016). How to Cure Cannabis Buds. Leafly.
- De-Ping, G., & Jing, J. (2019). A Review of the Phytochemistry and Pharmacology of the Dried Flowers of Cannabis Sativa. Molecules, 24(16), 2981.
- Green, G. (2003). The Cannabis Grow Bible: The Definitive Guide to Growing Marijuana for Recreational and Medical Use. Green Candy Press.
- Stark, J. M., & Firestone, M. K. (1995). Mechanisms for soil moisture effects on activity of nitrifying bacteria. Applied and Environmental Microbiology, 61(1), 218-221.
- Nuutinen, T. (2018). Medicinal properties of terpenes found in Cannabis sativa and Humulus lupulus. European Journal of Medicinal Chemistry, 157, 198-228.
- Baron, E. P. (2018). Medicinal Properties of Cannabinoids, Terpenes, and Flavonoids in Cannabis, and Benefits in Migraine, Headache, and Pain: An…
Das Lexikon des Geschmacks: Eine Symphonie der Aromen
Hier ist euer Spickzettel, um die Sprache der Pflanzen zu verstehen. Jede dieser Verbindungen trägt zur einzigartigen Persönlichkeit eurer Ernte bei. Lernt sie kennen, und ihr werdet anfangen, nicht nur zu riechen, sondern zu verstehen.
| Verbindung | Typ | Aroma / Geschmack | Vorkommen (außerhalb Cannabis) | Mögliche Effekte | | Myrcen | Terpen | Erdig, moschusartig, fruchtig (Mango) | Mango, Hopfen, Thymian | Entspannend, sedierend, “Couch-Lock” | | Limonen | Terpen | Zitrusfrüchte (Zitrone, Orange) | Zitruschalen, Rosmarin, Wacholder | Stimmungsaufhellend, stresslösend, energetisierend | | Pinen (α & β) | Terpen | Kiefer, Tanne, harzig, frisch | Kiefernnadeln, Rosmarin, Basilikum | Fokus, mentale Klarheit, bronchialerweiternd | | Linalool | Terpen | Blumig, Lavendel, leicht würzig | Lavendel, Koriander, Birke | Beruhigend, angstlösend, schlaffördernd | | Caryophyllen | Terpen | Pfeffrig, würzig, holzig | Schwarzer Pfeffer, Nelken, Zimt | Entzündungshemmend, schmerzlindernd | | Humulen | Terpen | Erdig, holzig, hopfenartig | Hopfen, Koriander, Salbei | Appetitzügelnd, entzündungshemmend | | Terpinolen | Terpen | Kräuterartig, blumig, Hauch von Kiefer | Muskatnuss, Teebaum, Flieder | Leicht sedierend, antioxidativ | | Flavone | Flavonoid | (Beeinflusst eher Farbe & Synergie) | Petersilie, Sellerie | Entzündungshemmend, antioxidativ 1 | | Anthocyane | Flavonoid | (Verantwortlich für violette/blaue Farbtöne) | Beeren, rote Trauben, Rotkohl | Antioxidativ, neuroprotektiv 1 |
Referenzen
- Understanding the Soil Food Web | Dr. Elaine Ingham | joe gardener®, Zugriff am Juli 23, 2025
- How It Works - Soil Food Web School, Zugriff am Juli 23, 2025
- Dr. Elaine’s™ Soil Food Web School - Regenerating Soil - Regenerative Agriculture Courses, Zugriff am Juli 23, 2025
- Can the growth-differentiation balance hypothesis be tested rigorously? Oikos | Request PDF - ResearchGate, Zugriff am Juli 23, 2025
- Does the Growth Differentiation Balance Hypothesis Explain Allocation to Secondary Metabolites in Combretum apiculatum , an African Savanna Woody Species? - ResearchGate, Zugriff am Juli 23, 2025
- Costs of Defense and a Test of the Carbon-Nutrient Balance and…, Zugriff am Juli 23, 2025
- Calculating Cation Exchange Capacity, Base Saturation, and Calcium Saturation | Ohioline, Zugriff am Juli 23, 2025
- Cation Exchange Capacity and Base Saturation - UGA Cooperative Extension, Zugriff am Juli 23, 2025
- Cations and Cation Exchange Capacity | Fact Sheets | soilquality.org.au, Zugriff am Juli 23, 2025
- Cation Exchange Capacity - Soil Health Nexus, Zugriff am Juli 23, 2025
- No Till? : r/NoTillGrowery - Reddit, Zugriff am Juli 23, 2025
- The Truth About Compost Tea: Making it, Using it, and What to Expect from it - Piedmont Master Gardeners, Zugriff am Juli 23, 2025
- Essential pH Management in Greenhouse Crops: pH and Plant Nutrition, Zugriff am Juli 23, 2025
- What’s the (Compost) Tea?: Hot-and-Bothered by the Cold Brew - Holden Arboretum, Zugriff am Juli 23, 2025
- The Truth About Compost Tea, save time and money - Garden Myths, Zugriff am Juli 23, 2025
- Application of Lactic Acid Bacteria (LAB) in Sustainable Agriculture: Advantages and Limitations - PMC, Zugriff am Juli 23, 2025
- On-farm produced microbial soil inoculants effects on bread wheat (Triticum aestivum) production - Publication : USDA ARS, Zugriff am Juli 23, 2025
- Unraveling the Mystery of the Natural Farming System (Korean): Isolation of Bacteria and Determining the Effects on Growth - ScholarSpace, Zugriff am Juli 23, 2025
- Indigenous Microorganism (IMO) Research - Unadilla Community Farm, Zugriff am Juli 23, 2025
- The Development of Indigenous Microorganisms Using Korean Natural Farming Methods - CTAHR, Zugriff am Juli 23, 2025
- Indigenous Microorganism 4 (IMO 4) as a Soil Inoculant - UH System Repository, Zugriff am Juli 23, 2025
- Why are your soil microbes dormant? - PhycoTerra, Zugriff am Juli 23, 2025
- Soil Microbes and Plants: An Important Relationship - PhycoTerra, Zugriff am Juli 23, 2025
- This study talks about how terpene profile rather than strain type, was responsible for the effects of the high; ie sativa being energizing & indica being sedating. Apparently there is no genetic difference between the 2, I thought about this awhile before I found this article, kinda makes sense : r/cannabiscultivation - Reddit, Zugriff am Juli 23, 2025
- Comparison of the Cannabinoid and Terpene Profiles in Commercial Cannabis from Natural and Artificial Cultivation - PMC - PubMed Central, Zugriff am Juli 23, 2025
- Living mulch - Wikipedia, Zugriff am Juli 23, 2025
- What is Living Mulch? - Groton Garden Club, Zugriff am Juli 23, 2025
- Microorganisms in Agricultural Soil: Advances and Challenges of Biological Health, Zugriff am Juli 23, 2025
- Living mulch - Veganic Agriculture Network, Zugriff am Juli 23, 2025
- Soil Acidity and Liming - CTAHR, Zugriff am Juli 23, 2025
- Adjusting the pH in Living Soil | Skunk Global, Zugriff am Juli 23, 2025
- pH Adjustment in Containers When the pH is too high: - Department of Plant Sciences, Zugriff am Juli 23, 2025
- Soil Nutrient Retention and pH Buffering Capacity Are Enhanced by Calciprill and Sodium Silicate - MDPI, Zugriff am Juli 23, 2025
- Understanding pH for potting soil - General Fruit Growing, Zugriff am Juli 23, 2025
- Hard Water in Agriculture: The Challenges and the Most Effective Solution, Zugriff am Juli 23, 2025
- How to Check pH & Stop Cannabis Nutrient Deficiencies | Grow Weed Easy, Zugriff am Juli 23, 2025
- Cannabis Genetics and Terpene Profiles: Unraveling the Aromas and Flavors - FloraFlex, Zugriff am Juli 23, 2025
- Genomic characterization of the complete terpene synthase gene family from Cannabis sativa | PLOS One - Research journals, Zugriff am Juli 23, 2025
- Influence of Temperature Stress on the Major Cannabinoid Contents and Biosynthesis Gene Expression Levels in Industrial Hemp (Cannabis sativa L.) - 원예과학기술지, Zugriff am Juli 23, 2025
- Cannabinoids and Terpenes: How Production of Photo-Protectants Can Be Manipulated to Enhance Cannabis sativa L. Phytochemistry - Frontiers, Zugriff am Juli 23, 2025
- Cannabis Terpenes and the Impact of Light Spectrum, Zugriff am Juli 23, 2025
- The Impact of Light Quality on Cannabinoid and Terpene Production - FloraFlex Media, Zugriff am Juli 23, 2025
- How Grow Lighting Impacts Terpene and Flavor Profiles, Zugriff am Juli 23, 2025
- How Does UVB Affect Terpenes & Improves Harvest Quality - Trimleaf, Zugriff am Juli 23, 2025
- Ultraviolet Radiation, Cannabinoids & An Unequivocally Equivocal Contribution, Zugriff am Juli 23, 2025
- Vapour Pressure Deficit (VPD) in Cannabis Cultivation - Ripper Seeds, Zugriff am Juli 23, 2025
- (PDF) The Effects of Water-Deficit Stress on Cannabis sativa L. Development and Production of Secondary Metabolites: A Review - ResearchGate, Zugriff am Juli 23, 2025
- The Effects of Water-Deficit Stress on Cannabis sativa L. Development and Production of Secondary Metabolites: A Review - MDPI, Zugriff am Juli 23, 2025
- The Ultimate Vapor Pressure Deficit (VPD) Guide - Pulse Labs, Zugriff am Juli 23, 2025
- Gene Networks Underlying Cannabinoid and Terpenoid Accumulation in Cannabis - PMC, Zugriff am Juli 23, 2025
- Terpenes & temperature: how summer affects drying - DryRocket, Zugriff am Juli 23, 2025
- How to Maximize Trichome and Terpene Preservation - Mobius Trimmer, Zugriff am Juli 23, 2025
- Terpene Boiling Points and Temperature - True Labs for Cannabis, Zugriff am Juli 23, 2025
- Cannabis Drying and Terpene Preservation: Methods for Retaining Aroma and Flavor, Zugriff am Juli 23, 2025
- Cannabis drying temperature vs. terpene retention - Robust Solutions Pro, Zugriff am Juli 23, 2025
- Korean Natural Farming: LAB - Christine Hyung-Oak Lee, Zugriff am Juli 23, 2025
- Soil Microorganisms: Their Role in Enhancing Crop Nutrition and Health - MDPI, Zugriff am Juli 23, 2025
- Current Challenges and Pitfalls in Soil Metagenomics - MDPI, Zugriff am Juli 23, 2025
- Home Growing Cannabis? What container size and material is best for growing weed? - MontanaCanna, Zugriff am Juli 23, 2025
- The Impact of pH Adjusters on Soil Biology: Unveiling the Controversy - Dr Greenthumbs, Zugriff am Juli 23, 2025
- BUFFERING SYSTEMS, Zugriff am Juli 23, 2025
- Maintaining Terpene Profiles with Proper Humidity - Marijuana Packaging, Zugriff am Juli 23, 2025
- Reaching unreachables: Obstacles and successes of microbial cultivation and their reasons, Zugriff am Juli 23, 2025
- The Best Types of Pots For Growing Weed - RQS USA - Royal Queen Seeds, Zugriff am Juli 23, 2025
- Container Soils and Soilless Media - Nursery Crop Science, Zugriff am Juli 23, 2025
- Genetic and Environmental Factors Associated with Cannabis Involvement - PMC, Zugriff am Juli 23, 2025
- LED Grow Lights for Cannabis: Understanding the Role of UV Light, Zugriff am Juli 23, 2025