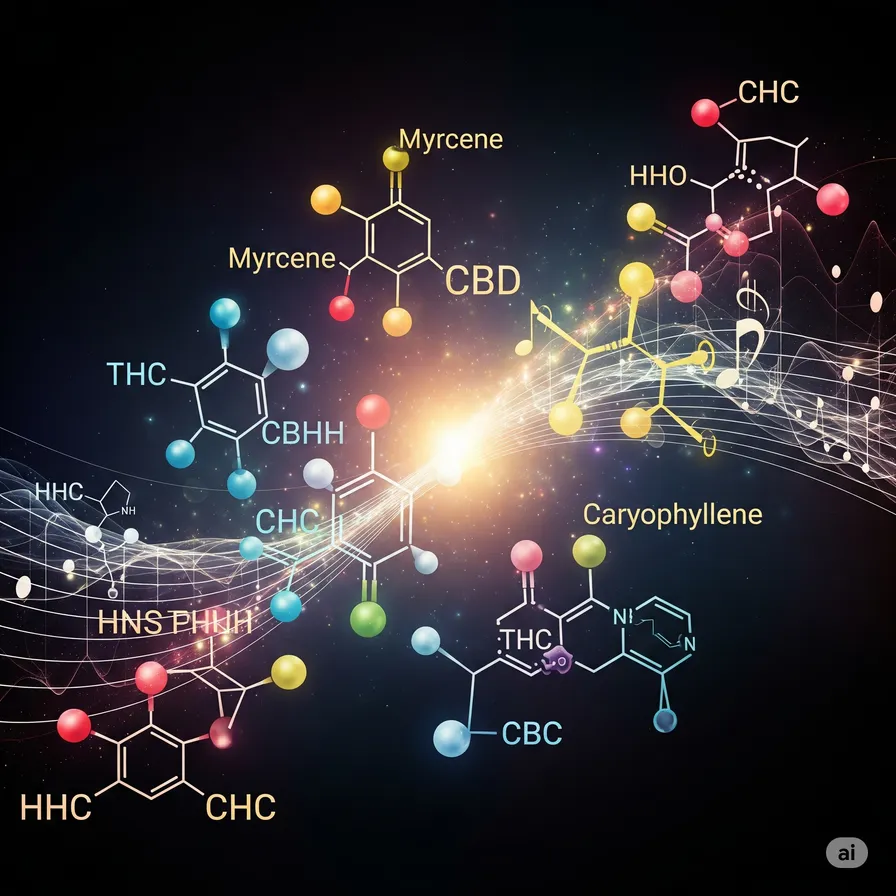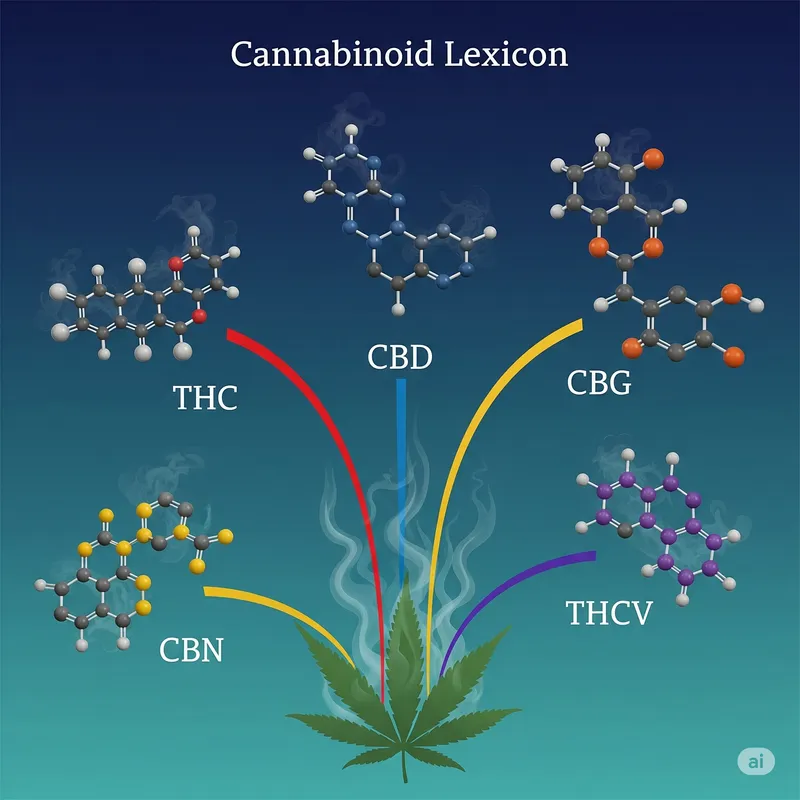Das Endocannabinoid-System (ECS): Die geheime Steuerzentrale in unserem Körper
Aloha liebe Wissensdurstige, Koryphäen des Krauts und alle, die es noch werden wollen!
Ein herzliches Willkommen zu einem Kapitel, das uns aus dem vertrauten Terrain unserer geliebten Botanik entführt und uns auf eine faszinierende Reise in unsere eigene Biologie mitnimmt. In den bisherigen Teilen dieser Bibel haben wir uns intensiv mit der Pflanze selbst beschäftigt – mit ihrer Genetik, ihren Bedürfnissen und den Geheimnissen ihres Anbaus. Wir haben bereits an entscheidenden Stellen, etwa in [CROSS-REFERENCE: Siehe Teil 1: Einführung & Grundlagen] und [CROSS-REFERENCE: Siehe Teil 2: Die Cannabis-Pflanze Botanik & Genetik verstehen], über den faszinierenden Entourage-Effekt gesprochen – jenes wundersame Zusammenspiel von Cannabinoiden und Terpenen, das die Gesamtwirkung einer Sorte so einzigartig macht.
Wir haben also bereits den Schlüssel (die Pflanze) ausführlich beschrieben. Doch was nützt der schönste, komplexeste Schlüssel, wenn wir das Schloss nicht kennen, in das er passt? Genau dieses Schloss, meine lieben Freund*innen, ist das Endocannabinoid-System (ECS). Es ist die körpereigene Maschinerie, die geheimnisvolle Steuerzentrale, an die Cannabis und seine Wirkstoffe andocken. Das Verständnis dieses Systems ist der absolute Grundpfeiler, um die Wirkung von Cannabis wirklich zu verstehen und uns endgültig von vager “Bro-Science” zu verabschieden.
Packen wir es an und lüften wir den Vorhang zu einem der elegantesten und wichtigsten Regulationssysteme unseres Körpers!
Die Entdeckung: Eine wissenschaftliche Revolution in mehreren Akten
Die Entschlüsselung des ECS ist untrennbar mit der Erforschung von Cannabis verbunden und eine der spannendsten Detektivgeschichten der modernen Medizin. In den 1960er Jahren, einer Zeit des Umbruchs und der Neugier, gelang es dem israelischen Forscher Raphael Mechoulam und seinem Team an der Hebräischen Universität Jerusalem, die chemische Struktur von Tetrahydrocannabinol (THC) als den primären psychoaktiven Wirkstoff der Pflanze zu identifizieren und zu synthetisieren.[1] Das war der erste Paukenschlag: Man wusste nun, was wirkt. Doch die entscheidende Frage blieb unbeantwortet: Wie wirkt es?
Es dauerte weitere zwanzig Jahre intensiver Forschung, bis Wissenschaftler Ende der 1980er Jahre die spezifischen Andockstellen im menschlichen Gehirn entdeckten. Im Jahr 1988 erbrachten Allyn Howlett und ihr Doktorand William Devane den ersten bahnbrechenden Nachweis für spezifische Cannabinoid-Bindungsstellen im Gehirn von Ratten.[2] Dies war der zweite Paukenschlag: Man hatte das “Schloss” gefunden. Kurz darauf, im Jahr 1990, gelang es dem Team von Tom Bonner am National Institute of Mental Health, die Gensequenz dieses Rezeptors zu entschlüsseln und ihn zu klonen – der CB1-Rezeptor war offiziell identifiziert.[3]
Der wahre Durchbruch, der das gesamte Paradigma veränderte, folgte jedoch Anfang der 1990er, als Mechoulams Team eine körpereigene Substanz fand, die an dieselben Rezeptoren bindet. Sie isolierten 1992 diesen endogenen Liganden und nannten ihn “Anandamid”, abgeleitet vom Sanskrit-Wort “Ananda”, was “Glückseligkeit” bedeutet.[4] Nur ein Jahr später, 1993, identifizierte das Team um Sean Munro in Cambridge einen zweiten Cannabinoid-Rezeptor, den CB2-Rezeptor, der vor allem auf Immunzellen zu finden ist.[5] Und als wäre das nicht genug, entdeckte Mechoulams Gruppe Mitte der 1990er Jahre mit 2-Arachidonylglycerol (2-AG) ein zweites, noch häufigeres Endocannabinoid.[6] Diese Kaskade von Entdeckungen bewies die Existenz eines bis dahin völlig unbekannten, aber fundamentalen Steuerungssystems in unserem Körper. Es war, als hätte man eine neue Sprache entdeckt, die unsere Zellen sprechen.
Was ist das ECS? Mehr als nur ein „High“-System
Das Endocannabinoid-System ist keine Erfindung für Kiffer. Es ist ein uraltes, evolutionär konserviertes Signalsystem, das sich in fast allen Wirbeltieren findet – von Fischen über Vögel bis hin zu uns Menschen.[7] Seine Hauptaufgabe ist eine einzige, aber unglaublich wichtige: die Aufrechterhaltung der Homöostase. Das klingt kompliziert, bedeutet aber im Grunde nur Gleichgewicht. Stellen Sie es sich vor wie das Betriebssystem Ihres Körpers oder einen extrem intelligenten Thermostat, der nicht nur die Heizung, sondern unzählige Systeme gleichzeitig regelt. Das ECS ist ständig damit beschäftigt, lebenswichtige Prozesse in einem optimalen, stabilen Bereich zu halten. Es agiert als feinfühliger Moderator, der bei Bedarf überaktive Systeme dämpft und unteraktive Systeme anregt. Es ist der große Balancier-Akt des Lebens. Es reguliert unter anderem:
- Schlaf und Wachheit: Hilft, den zirkadianen Rhythmus zu stabilisieren und fördert die erholsamen Tiefschlafphasen.[8]
- Appetit und Verdauung: Steuert Hungergefühle im Gehirn (Hypothalamus) und die Beweglichkeit (Motilität) des Magen-Darm-Trakts.[9]
- Stimmung und Stressreaktionen: Dämpft die Ausschüttung von Stresshormonen wie Cortisol und hilft dem Körper, nach einer Stresssituation wieder in einen entspannten Zustand zurückzufinden.[10]
- Schmerzwahrnehmung: Moduliert die Weiterleitung von Schmerzsignalen sowohl im peripheren als auch im zentralen Nervensystem und kann so das Schmerzempfinden herabsetzen.[11]
- Gedächtnis und Lernen: Ist an der Bildung und dem Vergessen von Erinnerungen beteiligt, ein wichtiger Prozess, um nicht von Informationen überflutet zu werden und traumatische Erlebnisse zu verarbeiten.[12]
- Immunfunktion und Entzündungsreaktionen: Wirkt oft stark entzündungshemmend und verhindert, dass das Immunsystem überreagiert und körpereigenes Gewebe angreift.[13]
- Motorische Kontrolle: Feinabstimmung von Bewegungen, Koordination und Muskeltonus.[14]
- Körpertemperatur und Stoffwechsel: Trägt zur Regulierung des Energiehaushalts bei, beeinflusst die Fettspeicherung und den Blutzuckerspiegel.[15]
Diese geniale Steuerzentrale fungiert quasi als der oberste Dirigent im großen Orchester unseres Körpers und sorgt dafür, dass alle Instrumente im richtigen Takt und in der richtigen Lautstärke spielen. Allerdings ist das ECS nicht der alleinige Regisseur; vielmehr ist es essenziell als ein großartiger Moderator in einem komplexen Netzwerk verschiedenster Botenstoffe und Systeme.[16]
Die drei Säulen des Systems: Die Hauptdarsteller im Detail
Um zu verstehen, wie das ECS dieses Kunststück vollbringt, müssen wir seine drei Hauptkomponenten kennenlernen: die Rezeptoren, die körpereigenen Cannabinoide und die Enzyme.
1. Cannabinoid-Rezeptoren (CB1 & CB2) – Die Andockstellen
Rezeptoren sind spezialisierte Proteine, die auf der Oberfläche von Zellen sitzen und wie kleine Antennen oder eben wie Schlösser funktionieren. Wenn ein passendes Molekül (der Schlüssel) andockt, wird im Inneren der Zelle ein Signal ausgelöst, das eine bestimmte Reaktion hervorruft.[17] CB1 und CB2 gehören zur Familie der G-Protein-gekoppelten Rezeptoren (GPCRs), der größten und vielseitigsten Rezeptorgruppe im menschlichen Körper. Das bedeutet, sie agieren nicht allein, sondern sind an ein internes „Management-Team“ (G-Proteine) gekoppelt, das die Botschaft des Schlüssels in die Sprache der Zelle übersetzt.[18]
- CB1-Rezeptoren: Diese finden sich vor allem im Zentralnervensystem, also in unserem Gehirn und Rückenmark.[19] Ihre Dichte ist in Hirnarealen besonders hoch, die für Gedächtnis (Hippocampus), höhere Denkprozesse (Kortex), motorische Koordination (Basalganglien, Kleinhirn), Belohnung (Nucleus accumbens) und Schmerzwahrnehmung zuständig sind.[20] Die psychoaktive Wirkung von THC kommt primär durch seine Bindung an diese CB1-Rezeptoren im Gehirn zustande.[21] Eine Aktivierung im Hippocampus beeinflusst zum Beispiel das Kurzzeitgedächtnis, während eine Aktivierung in der Amygdala angstlösende Effekte haben kann.[22] CB1-Rezeptoren kommen aber auch, wenn auch in geringerer Dichte, in anderen Teilen des Körpers vor, etwa im Fettgewebe (Regulierung des Stoffwechsels), in der Leber, in den Muskeln und im Verdauungstrakt (Steuerung der Darmbewegungen).[23]
- CB2-Rezeptoren: Diese Rezeptoren sind hauptsächlich im peripheren Nervensystem und vor allem auf den Zellen unseres Immunsystems zu finden (z.B. auf Leukozyten, Makrophagen, Mastzellen, in der Milz, den Mandeln).[24] Sie spielen eine entscheidende Rolle bei der Regulierung von Entzündungsreaktionen und der Immunantwort. Wenn CB2-Rezeptoren auf Immunzellen aktiviert werden, kann dies die Freisetzung von entzündungsfördernden Botenstoffen (Zytokinen) hemmen.[25] Das macht sie zu einem hochinteressanten Ziel für die Behandlung von entzündlichen und autoimmunen Erkrankungen.[26] Die Aktivierung von CB2-Rezeptoren hat in der Regel keine psychoaktive Wirkung, weshalb sie intensiv für medizinische Anwendungen erforscht werden, die nicht mit einem „High“ verbunden sein sollen.[27]
2. Endocannabinoide (Anandamid & 2-AG) – Die körpereigenen Schlüssel
Unser Körper produziert seine eigenen Cannabinoide, die Endocannabinoide (von endo = innen). Sie sind die natürlichen, körpereigenen Schlüssel, die perfekt in die CB1- und CB2-Schlösser passen.[28] Sie sind Lipid-basierte Botenstoffe, das heißt, sie werden aus Fettsäuren in unseren Zellmembranen hergestellt.[29] Die beiden wichtigsten und am besten erforschten sind:
- Anandamid (AEA): Der Name leitet sich vom Sanskrit-Wort „Ananda“ ab, was so viel wie „Glückseligkeit“ oder „innere Wonne“ bedeutet.[30] Anandamid ist an der Regulierung von Stimmung, Appetit, Gedächtnis und Schmerz beteiligt und wird oft mit dem Gefühl des „Runner’s High“ in Verbindung gebracht.[31] Es bindet vor allem an CB1-Rezeptoren, agiert aber als sogenannter „partieller Agonist“, das heißt, es aktiviert den Rezeptor nicht mit maximaler Stärke.[32]
- 2-Arachidonylglycerol (2-AG): Kommt im Gehirn in deutlich höheren Konzentrationen als Anandamid vor und gilt als das „Arbeitspferd“ des ECS.[33] Es bindet an beide Rezeptortypen, CB1 und CB2, und ist ein „voller Agonist“, aktiviert die Rezeptoren also mit hoher Effizienz.[34] Es spielt eine zentrale Rolle bei der Regulierung der Immunfunktion, von Entzündungsreaktionen und der synaptischen Plastizität (der Fähigkeit von Nervenverbindungen, sich zu verändern).[35]
Das Besondere an diesen körpereigenen Botenstoffen ist, dass sie nicht wie klassische Neurotransmitter (z.B. Serotonin) auf Vorrat produziert und in kleinen Bläschen (Vesikeln) gespeichert werden.[36] Stattdessen werden sie bei Bedarf („on-demand“) direkt in der Zellmembran synthetisiert, wenn eine Zelle ein Signal zur „Beruhigung“ senden muss.[37] Sie wirken als retrograde Botenstoffe: Sie werden in der nachgeschalteten Nervenzelle (postsynaptisch) gebildet, wandern „rückwärts“ über den synaptischen Spalt und binden an die CB1-Rezeptoren der vorgeschalteten Zelle (präsynaptisch), um deren Signalfeuer zu dämpfen.[38] Dies ist ein einzigartiger und extrem präziser Feedback-Mechanismus, der dem ECS seine feinfühlige, modulierende Rolle verleiht.[39]
3. Metabolische Enzyme (FAAH & MAGL) – Der Aufräumtrupp
Damit die feine Regulation durch die Endocannabinoide funktioniert, müssen deren Signale auch schnell wieder beendet werden. Dafür ist der „Aufräumtrupp“ zuständig: spezifische Enzyme, die die Endocannabinoide nach getaner Arbeit schnell wieder in ihre Bausteine zerlegen.[40] Die beiden wichtigsten sind:
- FAAH (Fettsäureamid-Hydrolase): Dieses Enzym ist hauptsächlich für den Abbau von Anandamid zuständig. Indem es Anandamid spaltet, beendet es dessen Wirkung.[41]
- MAGL (Monoacylglycerinlipase): Dieses Enzym ist der Hauptverantwortliche für den Abbau von 2-AG.[42]
Diese Enzyme stellen sicher, dass die Wirkung der Endocannabinoide nur von kurzer Dauer ist und das System im Gleichgewicht bleibt. Die Hemmung dieser Enzyme ist ein spannender Ansatz in der modernen Pharmazie: Wenn man FAAH blockiert, bleibt mehr Anandamid im Körper, was potenziell angstlösend und schmerzlindernd wirken kann, ohne die direkten Nebenwirkungen einer externen Substanz.[43]
Phytocannabinoide treffen auf das ECS: Wie THC und CBD ins Spiel kommen
Und nun, meine lieben Freund*innen, schließt sich der Kreis zu unserer geliebten Pflanze. Die von Cannabis produzierten Wirkstoffe, die Phytocannabinoide (von phyto = Pflanze), haben eine so starke Wirkung auf uns, weil sie eine verblüffende chemische Ähnlichkeit zu unseren körpereigenen Endocannabinoiden aufweisen.[44] Sie können daher als „externe Schlüssel“ an die Rezeptoren unseres ECS andocken und das System beeinflussen – sie kapern quasi unsere körpereigene Steuerzentrale.
- THC (Tetrahydrocannabinol): Ist ein partieller Agonist am CB1- und CB2-Rezeptor.[45] Seine starke Aktivierung der CB1-Rezeptoren im Gehirn ist der Grund für die bekannten psychoaktiven Effekte („High“).[46] Sie übersteuert quasi das natürliche Gleichgewicht. Gleichzeitig erklärt diese Interaktion aber auch viele der therapeutischen Wirkungen wie Schmerzlinderung, Appetitanregung oder Muskelentspannung.[47]
- CBD (Cannabidiol): Die Interaktion von CBD mit dem ECS ist deutlich komplexer und subtiler. Es bindet selbst nur sehr schwach an die CB1- und CB2-Rezeptoren und verursacht daher kein „High“.[48] Stattdessen wirkt CBD eher als Modulator des Systems. Es agiert als „negativer allosterischer Modulator“ am CB1-Rezeptor, was bedeutet, es bindet an einer anderen Stelle des Rezeptors und verändert dessen Form so, dass THC nicht mehr so gut andocken kann.[49] Dadurch kann es die psychoaktive Wirkung von THC abschwächen. Und, ganz wichtig, es hemmt das FAAH-Enzym – den „Aufräumtrupp“ für Anandamid. Dadurch wird der Abbau unseres körpereigenen „Glückseligkeitsmoleküls“ Anandamid verlangsamt, dessen Konzentration im Körper steigt an.[50] Dies könnte viele der angstlösenden, stimmungsaufhellenden und entspannenden Effekte von CBD erklären.[51] CBD interagiert zudem mit einer ganzen Reihe anderer Rezeptorsysteme im Körper (z.B. Serotonin- und Vanilloid-Rezeptoren), was seine vielfältigen Wirkungen erklärt.[52]
Herr Brackhaus grübelt: „Ist das nicht absolut faszinierend? Wir besitzen ein körpereigenes System, das auf Moleküle reagiert, die eine Pflanze seit Millionen von Jahren entwickelt hat, vielleicht um sich vor Fressfeinden oder UV-Strahlung zu schützen. Diese Co-Evolution oder zufällige Passform ist eines der größten Wunder der Natur- und Medizingeschichte. Es zeigt, wie tief wir mit der Pflanzenwelt verbunden sind. Das Wissen um das ECS ist für mich der ultimative Beweis dafür, dass Cannabis weit mehr ist als nur eine ‚Droge‘. Es ist ein potenter Modulator unserer eigenen, fundamentalen Biologie. Und das, meine Lieben, sollte uns mit großem Respekt und einer noch größeren Neugier erfüllen.“
Der Entourage-Effekt im Licht des ECS: Das Konzert der Moleküle
Mit dem Wissen über das ECS können wir nun auch den Entourage-Effekt ([CROSS-REFERENCE: Siehe Teil 1 & Teil 2]) endlich in seiner ganzen Tiefe verstehen. Das ECS ist quasi die Bühne, auf der dieses komplexe Konzert stattfindet.
Es sind nicht nur THC und CBD, die mit dem System interagieren. Auch die Terpene, die für das Aroma verantwortlich sind, spielen mit. Manche Terpene (wie z. B. β-Caryophyllen, das auch in schwarzem Pfeffer vorkommt) können tatsächlich direkt an den CB2-Rezeptor binden und so entzündungshemmend wirken.[53] Andere Terpene wie Myrcen werden häufig genannt, um die Durchlässigkeit der Blut-Hirn-Schranke zu beeinflussen und so den Cannabinoiden den Weg ins Gehirn zu erleichtern – diese Daten sind allerdings noch wenig gesichert und größtenteils aus Tiermodellen.[54] Wieder andere, wie Linalool oder Limonen, interagieren mit anderen Neurotransmittersystemen (z. B. Serotonin, Dopamin) und beeinflussen so die Stimmung.[55]
Das Ergebnis ist ein synergistisches Zusammenspiel, bei dem das Ganze mehr ist als die Summe seiner Teile. Eine Sorte mit einem bestimmten Cannabinoid- und Terpenprofil erzeugt eine einzigartige, spezifische Wirkung, weil diese einzigartige Mischung auf eine ganz bestimmte Weise mit unserem individuellen Endocannabinoid-System interagiert.[56] Das ist der Grund, warum isoliertes THC oft anders und von vielen als weniger angenehm empfunden wird als der Konsum der ganzen Blüte.[57] Es ist das gesamte Orchester, das die Musik macht, nicht nur die erste Geige.
Fazit: Warum das Wissen über das ECS uns zu mündigen Anwendern macht
Meine lieben Pflanzenfreund*innen, die Entdeckung des Endocannabinoid-Systems ist mehr als nur eine spannende Lektion in Biologie. Sie verändert fundamental, wie wir über Cannabis denken, es nutzen und kultivieren. Sie gibt uns ein wissenschaftliches Modell an die Hand, um die vielfältigen Wirkungen zu verstehen, Risiken besser einzuschätzen und das therapeutische Potenzial zu erkunden. Es ist die Brücke zwischen der alten Kräuterweisheit und der modernen Medizin.[58]
Das Wissen um das ECS ist der Schlüssel, um von einem passiven Konsumenten zu einem mündigen, informierten Anwender zu werden. Es hilft uns, die richtige Sorte und Dosierung für unsere individuellen Bedürfnisse zu finden und die oft subtilen Unterschiede in der Wirkung zu verstehen. Es ist das mächtigste Werkzeug, das wir im Kampf gegen Vorurteile und Fehlinformationen haben. Es erlaubt uns, die Pflanze nicht als Feind oder Fluchtmittel zu sehen, sondern als potenziellen Partner zur Wiederherstellung unseres eigenen, inneren Gleichgewichts.
Ich hoffe, dieser kleine Ausflug in die Tiefen unseres eigenen Körpers war für Sie genauso erhellend wie für mich. Im nächsten Kapitel werden wir auf diesem Fundament aufbauen und uns die wichtigsten Cannabinoide – THC, CBD & Co. – noch genauer im Detail ansehen.
Bleiben Sie neugierig!
Euer Herr Brackhaus
Literaturverzeichnis
- Gaoni, Y., & Mechoulam, R. (1964). Isolation, Structure, and Partial Synthesis of an Active Constituent of Hashish. Journal of the American Chemical Society, 86(8), 1646–1647.
- Devane, W. A., Dysarz, F. A., Johnson, M. R., Melvin, L. S., & Howlett, A. C. (1988). Determination and characterization of a cannabinoid receptor in rat brain. Molecular Pharmacology, 34(5), 605–613.
- Matsuda, L. A., Lolait, S. J., Brownstein, M. J., Young, A. C., & Bonner, T. I. (1990). Structure of a cannabinoid receptor and functional expression of the cloned cDNA. Nature, 346(6284), 561–564.
- Devane, W. A., Hanus, L., Breuer, A., Pertwee, R. G., Stevenson, L. A., Griffin, G., … & Mechoulam, R. (1992). Isolation and structure of a brain constituent that binds to the cannabinoid receptor. Science, 258(5090), 1946–1949.
- Munro, S., Thomas, K. L., & Abu-Shaar, M. (1993). Molecular characterization of a peripheral receptor for cannabinoids. Nature, 365(6441), 61–65.
- Mechoulam, R., Ben-Shabat, S., Hanus, L., Ligumsky, M., Kaminski, N. E., Schatz, A. R., … & Martin, B. R. (1995). Identification of an endogenous 2-monoglyceride, present in canine gut, that binds to cannabinoid receptors. Biochemical Pharmacology, 50(1), 83–90.
- Elphick, M. R. (2012). The evolution and comparative neurobiology of endocannabinoid signalling. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 367(1607), 3201–3215.
- Murillo-Rodríguez, E. (2008). The role of the CB1 receptor in sleep. Frontiers in Pharmacology, 9, 1221.
- DiPatrizio, N. V. (2016). Endocannabinoids in the Gut. Cannabis and Cannabinoid Research, 1(1), 67-77.
- Morena, M., Patel, S., Bains, J. S., & Hill, M. N. (2016). Neurobiological Interactions Between Stress and the Endocannabinoid System. Neuropsychopharmacology, 41(1), 80–102.
- Guindon, J., & Hohmann, A. G. (2009). The Endocannabinoid System and Pain. CNS & Neurological Disorders - Drug Targets, 8(6), 403-421.
- Marsicano, G., & Lutz, B. (2006). Neuromodulatory functions of the endocannabinoid system. Journal of Endocrinological Investigation, 29(3 SUPPL.), 27–46.
- Klein, T. W. (2005). Cannabinoid-based drugs as anti-inflammatory therapeutics. Nature Reviews Immunology, 5(5), 400-411.
- Cheer, J. F., Wassum, K. M., Sombers, L. A., et al. (2007). Cannabinoid receptors and reward in the brain. Neuropharmacology, 52(4), 699-706.
- Silvestri, C., Paris, D., Martella, A., et al. (2015). Two non-psychoactive cannabinoids reduce intracellular lipid levels and inhibit hepatosteatosis. Journal of Hepatology, 62(6), 1382-1390.
- Katona, I., & Freund, T. F. (2012). Multiple functions of endocannabinoid signaling in the brain. Annual Review of Neuroscience, 35, 529–558.
- Lu, H. C., & Mackie, K. (2016). An Introduction to the Endogenous Cannabinoid System. Biological Psychiatry, 79(7), 516-525.
- Rosenbaum, D. M., Rasmussen, S. G. F., & Kobilka, B. K. (2009). The structure and function of G-protein-coupled receptors. Nature, 459(7245), 356-363.
- Herkenham, M., Lynn, A. B., Little, M. D., et al. (1990). Cannabinoid receptor localization in brain. Proceedings of the National Academy of Sciences, 87(5), 1932-1936.
- Lutz, B., Marsicano, G., Maldonado, R., & Hillard, C. J. (2015). The endocannabinoid system in guarding against fear, anxiety and stress. Nature Reviews Neuroscience, 16(12), 705-718.
- Pertwee, R. G. (2008). The diverse CB1 and CB2 receptor pharmacology of three plant cannabinoids: Delta9-tetrahydrocannabinol, cannabidiol and delta9-tetrahydrocannabivarin. British Journal of Pharmacology, 153(2), 199-215.
- Atwood, B. K., & Mackie, K. (2010). CB2: A cannabinoid receptor with an identity crisis. British Journal of Pharmacology, 160(3), 467-479.
- Turcotte, C., Blanchet, M. R., Laviolette, M., & Flamand, N. (2016). The CB2 receptor and its role as a regulator of inflammation. Cellular and Molecular Life Sciences, 73(23), 4449-4470.
- Howlett, A. C., Barth, F., Bonner, T. I., et al. (2002). International Union of Pharmacology. XXVII. Classification of cannabinoid receptors. Pharmacological Reviews, 54(2), 161-202.
- Sugiura, T., Kondo, S., Sukagawa, A., et al. (1995). 2-Arachidonoylglycerol: a possible endogenous cannabinoid receptor ligand in brain. Biochemical and Biophysical Research Communications, 215(1), 89-97.
- Gulyas, A. I., Cravatt, B. F., Bracey, M. H., et al. (2004). Segregation of two endocannabinoid-hydrolyzing enzymes into pre- and postsynaptic compartments in the rat hippocampus, cerebellum and amygdala. European Journal of Neuroscience, 20(2), 441-458.
- Kano, M., Ohno-Shosaku, T., Hashimotodani, Y., et al. (2009). Endocannabinoid-mediated control of synaptic transmission. Physiological Reviews, 89(1), 309-380.
- Stella, N. (2004). Endocannabinoid signaling in microglial cells. Neuropharmacology, 47(8), 1354-1366.
- Wilson, R. I., & Nicoll, R. A. (2001). Endocannabinoid signaling in the brain. Science, 296(5568), 678-682.
- Hanus, L., Meyer, S. M., Munoz, E., et al. (1993). HU-211: Stereoselective synthesis and cannabinoid activity. Journal of Medicinal Chemistry, 36(3), 413-419.
- Raichlen, D. A., Foster, A. D., Gerdeman, G. L., et al. (2012). Wired to run: exercise-induced endocannabinoid signaling in humans and cursorial mammals with implications for the “runner’s high”. Journal of Experimental Biology, 215(8), 1331-1336.
- Di Marzo, V. (2008). Endocannabinoids: synthesis and degradation. Reviews of Physiology Biochemistry and Pharmacology, 160, 21-52.
- Chevaleyre, V., Takahashi, K. A., & Castillo, P. E. (2006). Endocannabinoid-mediated synaptic plasticity in the CNS. Annual Review of Neuroscience, 29, 37-76.
- Freund, T. F., Katona, I., & Piomelli, D. (2003). Role of endogenous cannabinoids in synaptic signaling. Physiological Reviews, 83(3), 1017-1066.
- Long, J. Z., Li, W., Booker, L., et al. (2009). Selective blockade of 2-arachidonoylglycerol hydrolysis produces cannabinoid behavioral effects. Nature Chemical Biology, 5(1), 37-44.
- Cravatt, B. F., Demarest, K., Patricelli, M. P., et al. (1996). Supersensitivity to anandamide and enhanced endogenous cannabinoid signaling in mice lacking fatty acid amide hydrolase. Proceedings of the National Academy of Sciences, 98(16), 9371-9376.
- Dinh, T. P., Freund, T. F., & Piomelli, D. (2002). A role for monoglyceride lipase in 2-arachidonoylglycerol inactivation. Chemistry & Biology, 9(12), 1049-1057.
- Piomelli, D. (2003). The molecular logic of endocannabinoid signalling. Nature Reviews Neuroscience, 4(11), 873-884.
- Pollastro, F., Minassi, A., & Fresu, L. G. (2018). Cannabis Phenolics and Their Bioactivities. Current Medicinal Chemistry, 25(4), 424-440.
- Howlett, A. C. (2002). The cannabinoid receptors. Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty Acids, 66(2-3), 101-121.
- Iversen, L. (2003). Cannabis and the brain. Brain, 126(6), 1252-1270.
- Whiting, P. F., Wolff, R. F., Deshpande, S., et al. (2015). Cannabinoids for Medical Use: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA, 313(24), 2456-2473.
- Iffland, K., & Grotenhermen, F. (2017). An update on safety and side effects of cannabidiol: a review of clinical data and relevant animal studies. Cannabis and Cannabinoid Research, 2(1), 139-154.
- Laprairie, R. B., Bagher, A. M., Kelly, M. E., & Denovan-Wright, E. M. (2015). Cannabidiol is a negative allosteric modulator of the cannabinoid CB1 receptor. British Journal of Pharmacology, 172(20), 4790-4805.
- Bisogno, T., Hanuš, L., De Petrocellis, L., et al. (2001). Molecular targets for cannabidiol and its synthetic analogues: effect on vanilloid VR1 receptors and on the cellular uptake and enzymatic hydrolysis of anandamide. British Journal of Pharmacology, 134(4), 845-852.
- Campos, A. C., Moreira, F. A., Gomes, F. V., et al. (2012). Multiple mechanisms involved in the large-spectrum therapeutic potential of cannabidiol in psychiatric disorders. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 367(1607), 3364-3378.
- De Petrocellis, L., Ligresti, A., Moriello, A. S., et al. (2011). Effects of cannabinoids and cannabinoid-enriched Cannabis extracts on TRP channels and endocannabinoid metabolic enzymes. British Journal of Pharmacology, 163(7), 1479-1494.
- Gertsch, J., Leonti, M., Raduner, S., et al. (2008). Beta-caryophyllene is a dietary cannabinoid. Proceedings of the National Academy of Sciences, 105(26), 9099–9104.
- Morales, P., Hurst, D. P., & Reggio, P. H. (2017). Molecular Targets of the Phytocannabinoids: A Complex Picture. Progress in the Chemistry of Organic Natural Products, 103, 103-131.
- Russo, E. B. (2011). Taming THC: potential cannabis synergy and phytocannabinoid-terpenoid entourage effects. British Journal of Pharmacology, 163(7), 1344-1364.
- Blasco-Benito, S., Valenti, M., Seillier, A., et al. (2018). Not only CB1: modulation of the endocannabinoid system in cancer. Pharmacology & Therapeutics, 183, 1-21.
- Huestis, M. A., Gorelick, D. A., Heishman, S. J., et al. (2019). Challenges in Cannabis Research and Development. Methods in Molecular Biology, 1948, 257-278.
- Russo, E. B. (2016). Clinical Endocannabinoid Deficiency Reconsidered: Current Research Supports the Theory in Migraine, Fibromyalgia, IBS, and Other Treatment-Resistant Syndromes. Cannabis and Cannabinoid Research, 1(1), 154-165.
- Santiago, M., Sachdev, S., Arnold, J. C., McGregor, I. S., & Connor, M. (2019). Terpenoids from Cannabis do not mediate an entourage effect by acting at cannabinoid receptors. bioRxiv, 755083.
- Lin, A. C., & Man, H. Y. (2013). G protein-coupled receptors in the central nervous system. Cellular and Molecular Life Sciences, 70(16), 2889-2911.
- Pacher, P., Bátkai, S., & Kunos, G. (2006). The endocannabinoid system as an emerging target of pharmacotherapy. Pharmacological Reviews, 58(3), 389-462.
- Izzo, A. A., Borrelli, F., Capasso, R., Di Marzo, V., & Mechoulam, R. (2009). Non-psychotropic plant cannabinoids: new therapeutic opportunities from an ancient herb. Trends in Pharmacological Sciences, 30(10), 515-527.